-

© Ernestine von der Osten-Sacken
27.08.2025Der Reiz des Unbekannten
Menschen wie Hilja Hoevenberg kennt man sonst nur aus Ermittler-Serien: Als „Sachverständige für Personenidentifizierung und Gesichtsweichteilrekonstruktion“ am Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Landeskriminalamts (LKA) Berlin forscht sie auf einem Gebiet, das Anthropologie und Anatomie lange Zeit ad acta gelegt hatten: Sie rekonstruiert die Gesichter unbekannter Opfer. Im engen Austausch steht sie dabei auch mit dem Institut für Anatomie der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Ihre Forschung hilft nicht nur den ermittelnden Kolleginnen und Kollegen, sondern auch den Angehörigen der Opfer.
Im November 1988 fand man im Spandauer Stadtforst die bereits halbskelettierte Leiche einer Frau. Sie lag in einer Grube, die offenbar von Tieren aufgewühlt worden war. Der Leichnam war in einen Jutesack gewickelt, um den Hals zwei kurze Kunststofftaue. Die Frau war offenbar ermordet worden. Wie und warum sie ums Leben kam, ist bis heute nicht geklärt. Ebenso wenig, wer sie war. Bis heute sucht das Bundeskriminalamt nach Hinweisen: Auf der Seite der internationalen Fahndungskampagne „Identify Me“ ist sie als eine von 45 unbekannten Frauen gelistet, die ermordet wurden oder unter ungeklärten Umständen gestorben sind. Auch ein rekonstruiertes Porträt der Spandauer Toten ist dort zu sehen. Darunter der Hinweis „Auf den Schädel wurde eine Gesichtsweichteilrekonstruktion modelliert.“
2025 wurde dieser „Cold Case“ erneut aufgenommen. Die zuständige Mordkommission beantragte beim Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Landeskriminalamts (LKA) Berlin neue Untersuchungen, unter anderem eine neue Gesichtsrekonstruktion auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Korrelationen zwischen Knochenstrukturen und Weichteilgewebe der Kopf/Halsregion“. Hilja Hoevenberg betreut das Projekt am KTI. Glatte blonde Haare, schwarzes T-Shirt, das Gesicht ungeschminkt: die „Sachverständige für Personenidentifizierung und Gesichtsweichteilrekonstruktion“ wirkt offen und zugleich sehr engagiert: „Bei der Personenidentifizierung geht es sowohl um Opfer als auch um Täter. Ich vergleiche morphologische Merkmale anhand von Bildaufnahmen, um Personen zu identifizieren“, erläutert sie. Hilja Hoevenberg ist eine von rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des größten Kriminaltechnischen Instituts Deutschlands. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bereichen wie Physik, Chemie, Biologie, Biochemie, Psychologie und Linguistik unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit am Tatort und der Spurensicherung. Und sie forschen in interdisziplinär angelegten Projekten gemeinsam mit Technikspezialistinnen und -spezialisten an neuen Lösungen und Methoden zur Aufklärung und Prävention von Verbrechen. Dabei arbeiten sie international vernetzt mit Behörden, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammen. Hilja Hoevenberg ist mit ihrem Projekt als Gastwissenschaftlerin an das Institut für Funktionale Anatomie der Charité – Universitätsmedizin Berlin angebunden – und betritt damit eine in der Fachwelt lange aufgegebene Forschungsnische.
Bach und Neandertaler – frühe Versuche floppten
„Die Idee, Körperweichteile anhand von knöchernen Überresten zu rekonstruieren, geht zurück auf Georges Cuvier, Mitbegründer der Zoologie und der Vergleichenden Anatomie. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schlug er vor, unvollständige fossile Skelette zu ergänzen und die dazugehörigen Muskeln aus den Knochenstrukturen abzuleiten und zu modellieren, um einen Eindruck vom Typus einer bestimmten fossilen Tierart zu bekommen“, erläutert Hoevenberg. Cuviers Idee wurde nach 1850 von anderen aufgegriffen. Das damalige Problem: Man arbeitete mit metrischem Verfahren und kombinierte die Messwerte mit statistischen Daten. So entstanden recht pauschale Kategorien: „typische Einzelmaße“ verschiedener Körperteile, aus denen „Rassetypen“ oder „Geschlechtstypen“ bestimmt wurden. Diese Durchschnittswerte wurden auch zur Identifikation von Individuen genutzt, was nur bedingt funktionierte.
Spannendes Beispiel: 1894 beauftragte die Stadt Leipzig den Anatomen Wilhelm His damit, das Skelett eines Mannes zu identifizieren, das bei Erweiterungsarbeiten an der Johanniskirche gefunden worden war. Man vermutete, dass es sich um den Komponisten Johann Sebastian Bach handeln könne. His fertigte ein Knochengutachten an und verglich den Schädel mit Porträtgemälden von Bach, die allerdings erst nach dem Tode des Komponisten entstanden waren. Der Bildhauer Carl Ludwig Seffner schuf auf dieser Basis eine „Reproduction von Bach’s Zügen über den Schädelabguss“ und bezog sich dabei auf errechnete Durchschnittswerte aus Weichteildickenmessungen an acht gesunden älteren männlichen Leichen. Das Ergebnis übertraf laut His zwar „an Leben und charaktervollen Ausdruck jedes einzelne der Bilder“ – war aber eher ein künstlerisches Werk als eine wissenschaftliche Rekonstruktion des Komponistenkopfes.
Ähnlich erging es dem „Neandertaler aus La Chapelle-aux-Saints“: Wissenschaftler aus aller Welt versuchten Anfang des 20. Jahrhunderts das Gesicht des Steinzeitmenschen anhand seines 1908 in Frankreich gefundenen, fragmentierten Schädels zu rekonstruieren. Die Ergebnisse fielen vollkommen unterschiedlich aus. Dies veranlasste den deutschen Anatomen Heinrich von Eggeling, die Genauigkeit der Gesichtsrekonstruktion anhand von Weichteildurchschnittswerten zu überprüfen. Wie andere seiner wissenschaftlichen Zeitgenossen kam von Eggeling zu dem Schluss, dass auf dem Schädel lediglich der anthropologische Typus rekonstruiert werden könne, nicht aber individuelle Gesichtszüge. „Um 1930 wurde die Tür in der Forschung zur Gesichtsweichteilerekonstruktion im Grunde dicht gemacht“, so Hoevenberg. „Die numerische Methode mit Durchschnittswerten hatte sich als nicht erfolgversprechend für eine Rekonstruktion des individuellen Gesichts erwiesen.“
Mit Hollywood zurück ins Rampenlicht
Das Thema lag brach. Erst der US-Thriller „Gorky Park“ rückte die Gesichtskonstruktion 1983 wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit: In dem Film werden drei Leichen mit entstellten Gesichtern mittels wissenschaftlicher Nachbildungen identifiziert. 1993 formulierte die russische Anthropologin Natalia Lebedinskaya in ihren „Principles of Facial Reconstruction“ zwei ungelöste methodische Hauptprobleme: die Wechselbeziehung zwischen Weichteilgewebe und Knochenstrukturen sowie fehlende verbindliche Formbestimmungsregeln.
Hier setzt Hilja Hoevenbergs Forschung an. Den Anstoß zu ihrem heutigen Projekt am KTI gab ein realer Fall: „2003 wurde im Hafen von Wittenberge eine Wasserleiche gefunden, die nicht identifiziert werden konnte. Die Kollegen haben sich bei mir erkundigt, ob ich das Gesicht rekonstruieren könne. Ich habe zunächst eine ausführliche Literaturrecherche gemacht und dann beim Institut für Anatomie der Charité angefragt, ob eine Zusammenarbeit im Rahmen einer Masterarbeit möglich wäre. Der damalige Leiter, Prof. Dr. Robert Nitsch war sehr hilfsbereit und ermöglichte mir, an den Körpern von Spendern systematisch zu arbeiten. Daraus entstand dann das heutige Forschungsprojekt.“
Vier Jahre lang präparierte Hilja Hoevenberg und suchte nach Korrelationen zwischen Knochenstrukturen und Weichteilgewebe. Von dort aus ging es an die Formulierung von Formbestimmungsregeln. „Die Regeln wurden in Blindversuchen überprüft und anfangs nicht bestätigt, ich habe gelernt enttäuschungsresistent zu sein“, erinnert sie sich. Eine erste wesentliche Erkenntnis ihrer Forschungsarbeit: „Wenn man die Kopf- und Halsregion so rekonstruieren möchte, dass ein individuelles Gesicht dargestellt wird, ist es wichtig, den gesamten ‚Bauplan' in seinen Einzelteilen nachzuformen. Dieser sollte anschließend Teil für Teil zusammengesetzt werden.“
Akribische Detailarbeit
In ihrer Rekonstruktionsarbeit achtet Hilja Hoevenberg darauf, alles, was an und bei der Leiche aufgefunden wird, sehr genau zu befunden. „Sobald die Rechtsmedizin die Todesursache untersucht hat, mache ich die Präparation. Ich schaue nach Forminformationen, notiere und fotografiere.“ Nachdem das Weichteilgewebe vom Schädel entfernt (mazeriert) wurde, wird die Rekonstruktion Stück für Stück aufgebaut: Muskel für Muskel, Knorpel für Knorpel. Anschließend werden Fettschichten aufgebracht und zum Schluss die Haut. Hoevenberg: „Das ist dann Modelliermasse, deren haptische Eigenschaften denen der Haut entsprechen. Die Muskeln werden aus Wachs geformt.“ In dieser Arbeitsphase kommt der gebürtigen Niederländerin ihr früheres Studium der Bildhauerei und Malerei sehr zugute. „Für die menschliche Wahrnehmung sind auch haptische Gestaltinformationen wichtig: ob etwas weich oder hart ist, glänzend oder stumpf erscheint, rau oder glatt ist. Das versuche ich in meiner Arbeit so weit wie möglich zu berücksichtigen.“ Um die Leiche für eine Rekonstruktion befunden zu können, arbeitet Hoevenberg – je nach Fall – mit Zahnärztinnen oder Zahnärzten oder anderen Fachärztinnen oder Fachärzten zusammen.
Mit ihrer Forschung ist Hilja Hoevenberg eine Wegbereiterin. Sie hilft nicht nur den Kolleginnen und Kollegen in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, auch für die Transplantationsmedizin könnten die Ergebnisse ihrer Arbeit interessant sein. Durch wissenschaftliche Schwarmintelligenz hofft sie das Thema weiter voranzubringen. Denn, so ihr Resümee: „Interdisziplinärer Austausch ist auch für die Forschung auf dem Gebiet der Gesichtsrekonstruktion entscheidend.“
Autorin: Ernestine von der Osten-Sacken
-
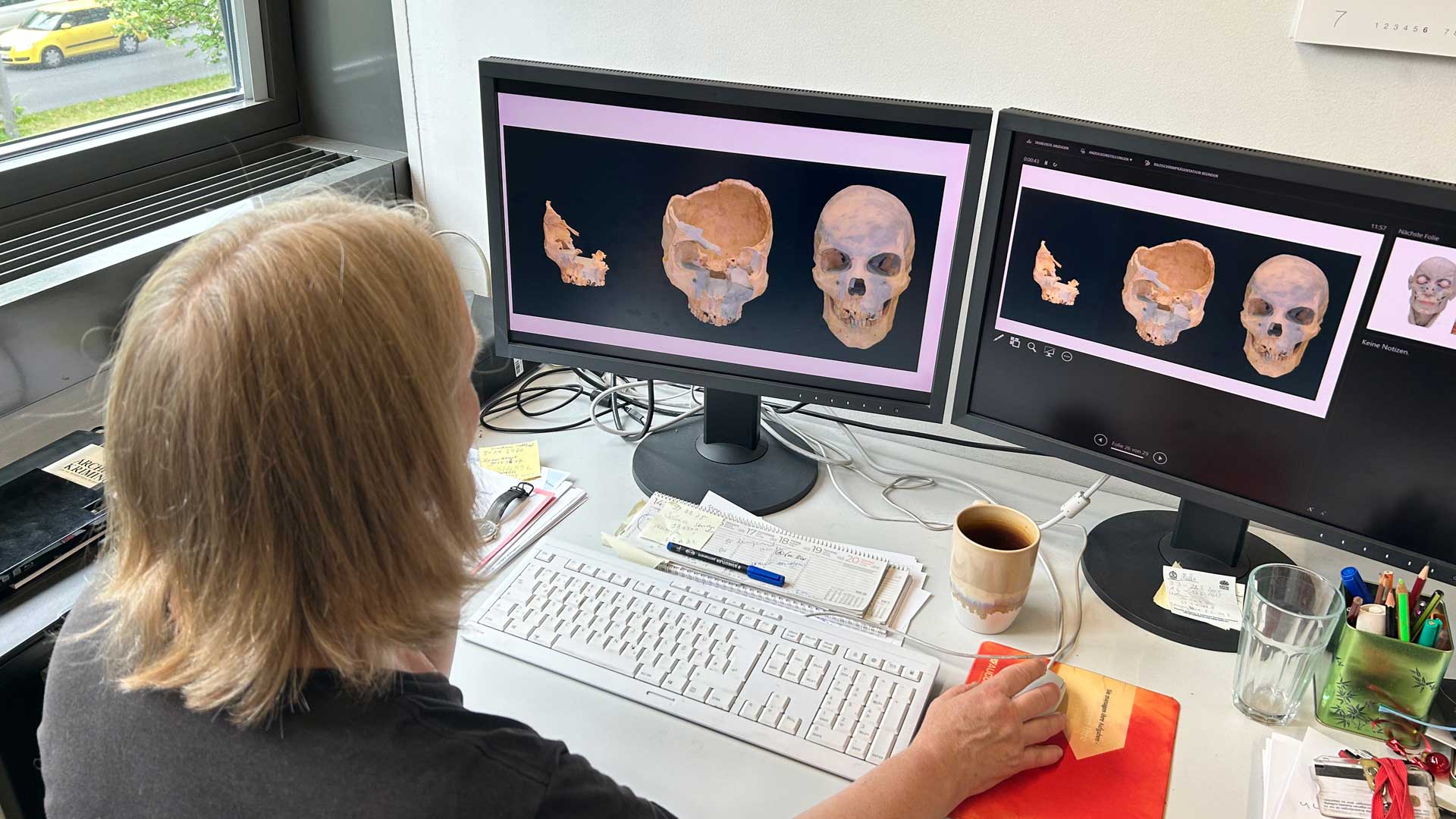 © Ernestine von der Osten-Sacken
© Ernestine von der Osten-Sacken
Hilja Hoevenberg forscht am KTI auf einem Gebiet, das Anthropologie und Anatomie lange Zeit ad acta gelegt haben. -
 © Ernestine von der Osten-Sacken
© Ernestine von der Osten-Sacken
Untersuchungen von Schmauch-, Lack- und Einbruchspuren gehören zu seinen Aufgaben. Auch Gemäldefälschern kommt er auf die Schliche: Dr. Paul Kuhlich leitet den Fachbereich Chemie/Physik am KTI. -
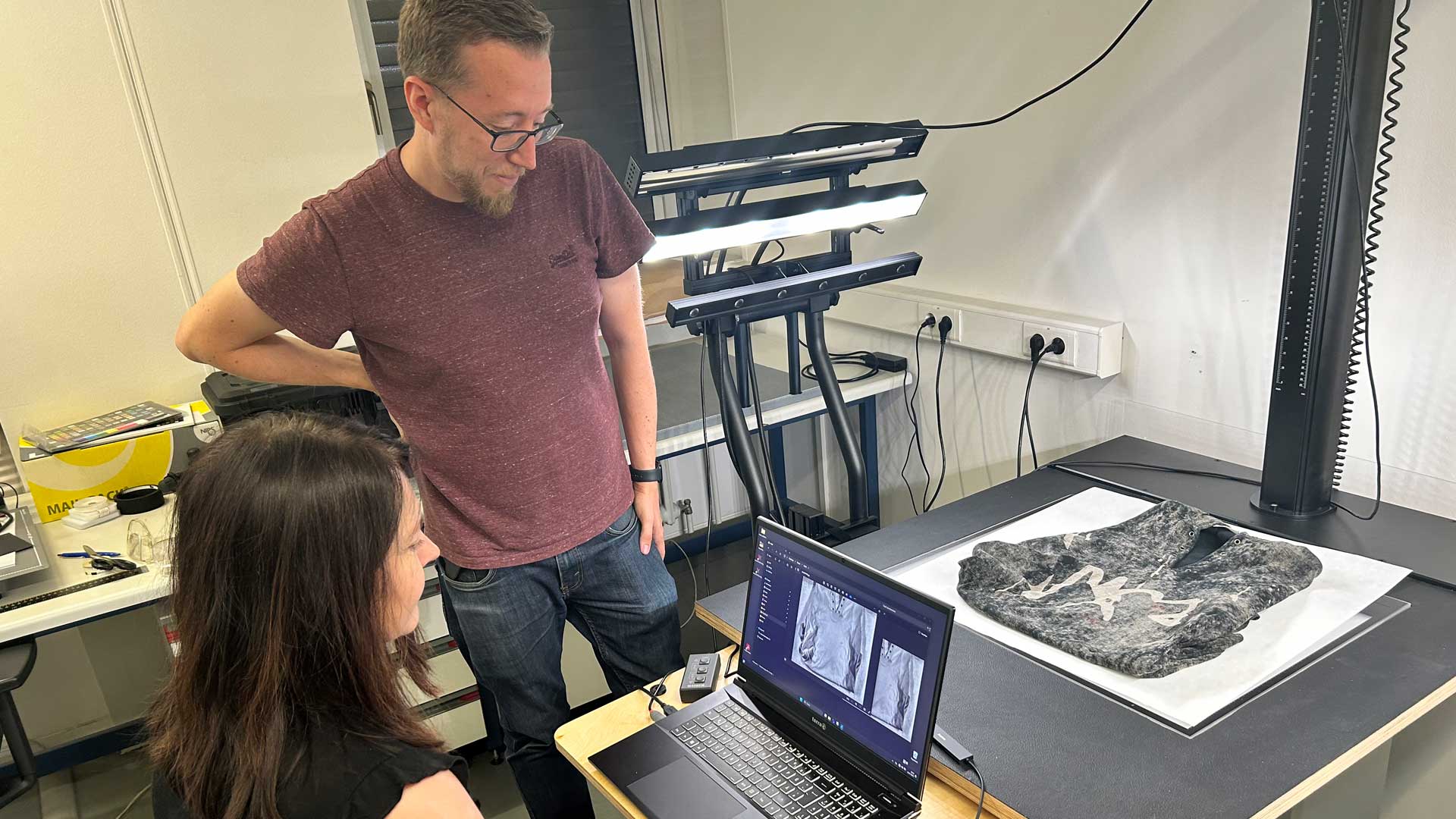 © Ernestine von der Osten-Sacken
© Ernestine von der Osten-Sacken
Katja Wild und Tim Skudlarek arbeiten als Fotografen am KTI. -
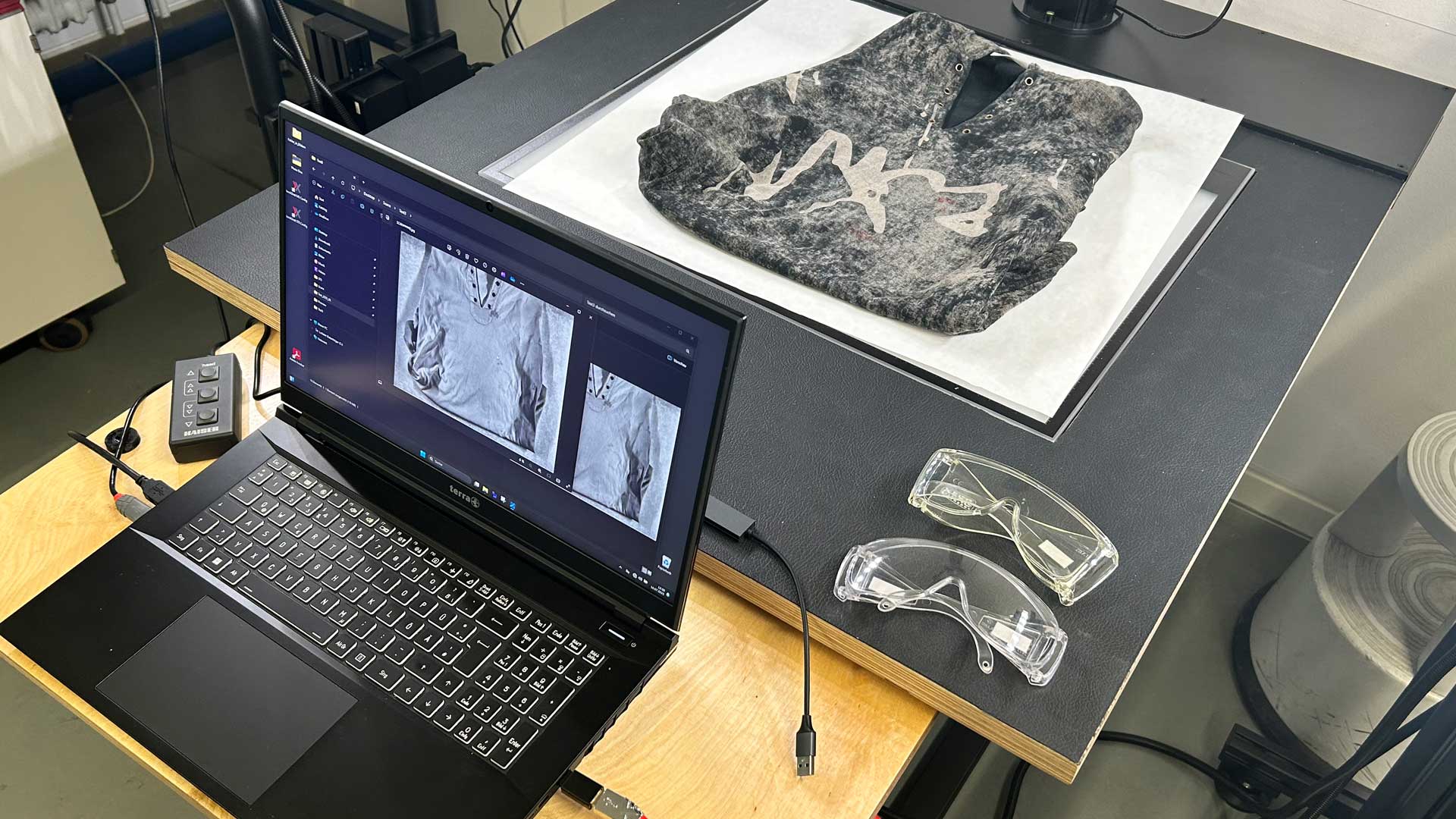 © Ernestine von der Osten-Sacken
© Ernestine von der Osten-Sacken
Mit dieser Multispektralkamera können sie Substanzen, die das Auge nicht erkennt, sichtbar machen. Zum Beispiel Blutspuren, Sperma oder Gemälderetuschen.
Mehr Stories
-
Transfer – Stories
 Transfer – StoriesVom 22. bis zum 26. November geht es auf der Transfer Week 2021 in digitalen Sessions darum, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu…→
Transfer – StoriesVom 22. bis zum 26. November geht es auf der Transfer Week 2021 in digitalen Sessions darum, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu…→Sensibilisierung für Wissens- und Technologietransfer: Transfer Week 2021
-
Facts & Events
 © FU Berlin/Bernd Wannenmacher
Facts & Events„Oral-History.Digital“ heißt ein in dieser Woche online gegangenes Portal. Die Universitätsbibliothek der FU Berlin ist Partnerin des von der DFG…→
© FU Berlin/Bernd Wannenmacher
Facts & Events„Oral-History.Digital“ heißt ein in dieser Woche online gegangenes Portal. Die Universitätsbibliothek der FU Berlin ist Partnerin des von der DFG…→Neue-Plattform für Zeitzeugen-Interviews
-
Insights Facts & Events
 © Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin
Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→
© Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin
Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin
-
Facts & Events
 © HTW Berlin/Chris Hartung
Facts & EventsVom 12. bis zum 16. Februar laden die Career Services der Universitäten und Hochschulen in Berlin und Brandenburg zur ersten gemeinsamen Career Week…→
© HTW Berlin/Chris Hartung
Facts & EventsVom 12. bis zum 16. Februar laden die Career Services der Universitäten und Hochschulen in Berlin und Brandenburg zur ersten gemeinsamen Career Week…→Tipps und Infos zum Berufseinstieg
-
Insights Transfer – Stories
 © Nikolaus Brade
Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→
© Nikolaus Brade
Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→Gemeinsames Potenzial entfalten
-
Insights Transfer – Stories
 © edelviz
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→
© edelviz
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→„Kollaboration statt Wettbewerb“
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Stefan Klenke / HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→
© Stefan Klenke / HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→Berliner Wissenschaftspreis für Prof. Dr. Philipp Adelhelm
-
Facts & Events
 © Beuth Hochschule / Karsten Flügel
Facts & EventsGebäude, Hörsäle und Labore in der Brain City Berlin sind zurzeit wegen der Corona-Pandemie für Studierende, Lehrende und Forschende geschlossen.…→
© Beuth Hochschule / Karsten Flügel
Facts & EventsGebäude, Hörsäle und Labore in der Brain City Berlin sind zurzeit wegen der Corona-Pandemie für Studierende, Lehrende und Forschende geschlossen.…→COVID-19: Berliner Hochschulen helfen
-
Transfer – Stories
 (V.li.n.re.) Steffen Terberl/FU Berlin; Prof. Dr. Hannes Rothe/ICN Business School, Foto: Ernestine von der Osten-Sacken
Transfer – StoriesIm Bereich BioTech verschenkt die Brain City Berlin Innovations-Potenzial. Zu diesem Schluss kommt der „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und…→
(V.li.n.re.) Steffen Terberl/FU Berlin; Prof. Dr. Hannes Rothe/ICN Business School, Foto: Ernestine von der Osten-Sacken
Transfer – StoriesIm Bereich BioTech verschenkt die Brain City Berlin Innovations-Potenzial. Zu diesem Schluss kommt der „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und…→„BioTech ist kein Selbstläufer“
-
Facts & Events
 firefly.adobe (AI-generated)
Facts & EventsEine Übersichts-Studie des GLEON-Netzwerks zeigt auf, welche Faktoren Blaualgen eindämmen können. Forschende des Berliner IGB waren daran beteiligt.→
firefly.adobe (AI-generated)
Facts & EventsEine Übersichts-Studie des GLEON-Netzwerks zeigt auf, welche Faktoren Blaualgen eindämmen können. Forschende des Berliner IGB waren daran beteiligt.→Starkregen, Fische und Bakterien: Was stoppt Blaualgen?
-
Startup Facts & Events
 Bildnachweis: © Samuel Stuart Hollenshead / NYU Photo Bureau
Startup Facts & EventsNew York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität.→
Bildnachweis: © Samuel Stuart Hollenshead / NYU Photo Bureau
Startup Facts & EventsNew York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität.→New York University wird strategische Partneruniversität der Humboldt-Universität
-
Facts & Events Transfer – Stories
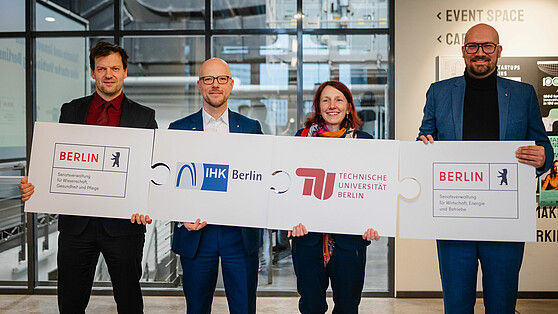 © IHK Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→
© IHK Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→Kooperation zwischen TU Berlin und IHK Berlin
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © BVG/Andreas Süß
Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→
© BVG/Andreas Süß
Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→Elektro-Sound der Zukunft
-
Facts & Events Innovationen
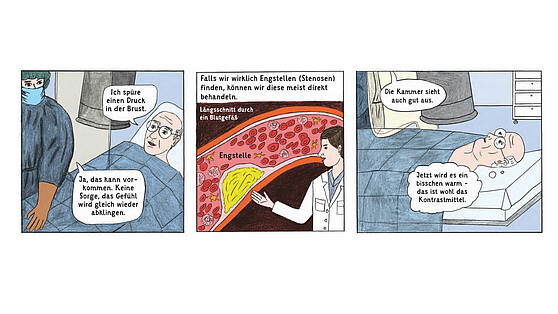 © Brand, Gao, Hamann, Martineck, Stangl/Charité
Facts & Events InnovationenMit einem Comic will die Charité-Universitätsmedizin Berlin Patientinnen und Patienten künftig vor einer Herzkatheter-Untersuchung aufklären. Im…→
© Brand, Gao, Hamann, Martineck, Stangl/Charité
Facts & Events InnovationenMit einem Comic will die Charité-Universitätsmedizin Berlin Patientinnen und Patienten künftig vor einer Herzkatheter-Untersuchung aufklären. Im…→Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
-
Transfer – Stories
 Credit: Markus Krutzik
Transfer – StoriesDr. Markus Krutzik, Leiter des Joint Lab Integrated Quantum Sensors (IQS), über die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ von der…→
Credit: Markus Krutzik
Transfer – StoriesDr. Markus Krutzik, Leiter des Joint Lab Integrated Quantum Sensors (IQS), über die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ von der…→„Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die in der Quantensensorik schlummern“
-
Startup Transfer – Stories
 © theion
Startup Transfer – StoriesDas Start-up theion will in der Brain City Berlin mit einer neuen Technologie den Batteriemarkt revolutionieren und die Energiewende beschleunigen.→
© theion
Startup Transfer – StoriesDas Start-up theion will in der Brain City Berlin mit einer neuen Technologie den Batteriemarkt revolutionieren und die Energiewende beschleunigen.→„Batterien made in Germany, made in Berlin”
-
Facts & Events
 © Terrartives, Crete, Greece
Facts & EventsKlimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht.→
© Terrartives, Crete, Greece
Facts & EventsKlimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht.→Klimaschutz, wo andere Urlaub machen: Wie Berliner Forschung den Mittelmeerraum resilienter macht
-
Transfer – Stories
 Gudrun Piechotta-Henze
Transfer – StoriesZum Wintersemester 2020/21 führt die Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin den ersten primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Pflege in der Brain…→
Gudrun Piechotta-Henze
Transfer – StoriesZum Wintersemester 2020/21 führt die Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin den ersten primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Pflege in der Brain…→„Wir müssen Pflege völlig neu denken!“ | 27.09.2019
-
Facts & Events
 shutterstock © andersphoto
Facts & EventsGleich mehrere hochrangige Forschungspreise gehen nach Berlin: Insgesamt fünf herausragende Forscher*innen erhielten Auszeichnungen des Europäischen…→
shutterstock © andersphoto
Facts & EventsGleich mehrere hochrangige Forschungspreise gehen nach Berlin: Insgesamt fünf herausragende Forscher*innen erhielten Auszeichnungen des Europäischen…→Preisgekrönt: 6 Auszeichnungen für Berliner Forscher*innen
-
Facts & Events
 Facts & EventsDie Berliner Fachhochschulen – vier staatliche und zwei konfessionelle – feiern Geburtstag. Anlässlich des gemeinsamen Jubiläums geben sie mit der…→
Facts & EventsDie Berliner Fachhochschulen – vier staatliche und zwei konfessionelle – feiern Geburtstag. Anlässlich des gemeinsamen Jubiläums geben sie mit der…→50 Jahre – 50 Geschichten
-
Facts & Events
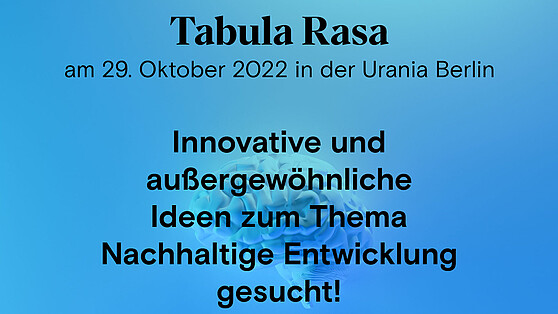 © Urania Berlin
Facts & EventsInnovative, kreative und außergewöhnliche Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Design suchen die Urania Berlin und die Berlin Science Week in der…→
© Urania Berlin
Facts & EventsInnovative, kreative und außergewöhnliche Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Design suchen die Urania Berlin und die Berlin Science Week in der…→Tabula rasa – bis zum 10. September bewerben!
-
Facts & Events
 © Berlin University Alliance
Facts & Events„Das offene Wissenslabor – für die großen Transformationen unserer Zeit“: Mit ihrer neuen Kampagne macht die Berlin University Alliance…→
© Berlin University Alliance
Facts & Events„Das offene Wissenslabor – für die großen Transformationen unserer Zeit“: Mit ihrer neuen Kampagne macht die Berlin University Alliance…→Berlin University Alliance launcht neue Kampagne
-
 Foto: Wissensstadt Berlin 2021/Alexander Rentsch
Unter dem Motto „Berlin will’s wissen" feiert die „Wissensstadt Berlin 2021“ den 200. Geburtstag von Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz. Auch im…→
Foto: Wissensstadt Berlin 2021/Alexander Rentsch
Unter dem Motto „Berlin will’s wissen" feiert die „Wissensstadt Berlin 2021“ den 200. Geburtstag von Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz. Auch im…→„Wissensstadt Berlin 2021“ – Highlights des Herbstprogramms
-
Facts & Events
 © Landesarchiv Berlin/Wunstorf
Facts & EventsDie Sprachwissenschaftlerin wurde am 27. Mai im Roten Rathaus vom Regierenden Bürgermeister, Kai Wegner, ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dr.…→
© Landesarchiv Berlin/Wunstorf
Facts & EventsDie Sprachwissenschaftlerin wurde am 27. Mai im Roten Rathaus vom Regierenden Bürgermeister, Kai Wegner, ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dr.…→Berliner Wissenschaftspreis 2023 für Artemis Alexiadou
-
Transfer – Stories
 Helena Lopes / Unsplash
Transfer – StoriesEin digitaler Lutscher, zarte Duftnoten per Mail verschicken oder sich den Wind virtuell um die Nase wehen lassen – die Forschung macht’s möglich. Ein…→
Helena Lopes / Unsplash
Transfer – StoriesEin digitaler Lutscher, zarte Duftnoten per Mail verschicken oder sich den Wind virtuell um die Nase wehen lassen – die Forschung macht’s möglich. Ein…→Die Welt mit allen Sinnen digital erleben | 18.06.2019
-
Insights
 Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)
InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→
Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)
InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→Das Beste aus der Wissenschaftsmetropole Berlin herausholen
-
Transfer – Stories
 © shutterstock/ Studio Romantic
Transfer – StoriesKönnen pflegebedürftige Menschen durch gezielte Bewegung wieder selbständiger werden? Das hat Brain City Botschafter Prof. Dr. Uwe Bettig im Projekt…→
© shutterstock/ Studio Romantic
Transfer – StoriesKönnen pflegebedürftige Menschen durch gezielte Bewegung wieder selbständiger werden? Das hat Brain City Botschafter Prof. Dr. Uwe Bettig im Projekt…→Wieder fit für daheim
-
Insights
 © FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University
InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→
© FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University
InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→Brücken schlagen zwischen Oxford und Berlin
-
Transfer – Stories
 © SCC Events/Norbert Wilhelmi
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Gabriele Mielke, Vizepräsidentin der VICTORIA | Internationale Hochschule und zugleich…→
© SCC Events/Norbert Wilhelmi
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Gabriele Mielke, Vizepräsidentin der VICTORIA | Internationale Hochschule und zugleich…→„Großveranstaltungen betreffen das Leben der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen“
-
Insights Transfer – Stories
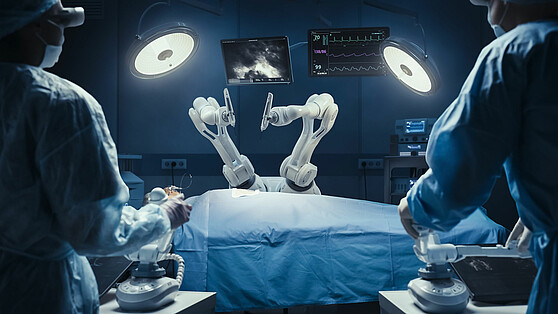 © Gorodenkoff / Shutterstock.com
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→
© Gorodenkoff / Shutterstock.com
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→Europäische Testinfrastruktur für KI im Gesundheitswesen
-
Transfer – Stories
 Falling Walls Foundation © Judith Schalansky
Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November trifft sich die Welt der Wissenschaft wieder in der Brain City Berlin. Organisationen können sich noch bis zum 31. Juli…→
Falling Walls Foundation © Judith Schalansky
Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November trifft sich die Welt der Wissenschaft wieder in der Brain City Berlin. Organisationen können sich noch bis zum 31. Juli…→„Trau dich, zu wissen“: Berlin Science Week 2022
-
Transfer – Stories
 ©Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde
Transfer – StoriesDas Kursangebot der HUWISU Summer University ist vielfältig und spannend, die Zielgruppe international: Studierende aus dem Ausland, die für einige…→
©Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde
Transfer – StoriesDas Kursangebot der HUWISU Summer University ist vielfältig und spannend, die Zielgruppe international: Studierende aus dem Ausland, die für einige…→Wenn Berlin zum Seminarraum wird ... | 15.08.2019
-
Facts & Events
 Prof. Claudia Langenberg; Prof. Marlis Dürkop-Leptihn; Prof. Gudrun Erzgräber, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Prof. Gesche Joost (v. li. n. re.), Foto: BIH/Konstantin Börner
Facts & EventsEmmanuelle Charpentier, Lise Meitner, Cécile Vogt – viele Berliner Wissenschaftlerinnen haben damals wie heute Bahnberechendes geleistet. Dennoch ist…→
Prof. Claudia Langenberg; Prof. Marlis Dürkop-Leptihn; Prof. Gudrun Erzgräber, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Prof. Gesche Joost (v. li. n. re.), Foto: BIH/Konstantin Börner
Facts & EventsEmmanuelle Charpentier, Lise Meitner, Cécile Vogt – viele Berliner Wissenschaftlerinnen haben damals wie heute Bahnberechendes geleistet. Dennoch ist…→Ausstellung: „Berlin – Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen“
-
Facts & Events
 © HTW Berlin/ Alexander Rentsch
Facts & EventsMit 51 Prozent verzeichnet die Brain City Berlin die höchste Quote an Hochschul-Erstabsolventinnen und -absolventen in Deutschland.→
© HTW Berlin/ Alexander Rentsch
Facts & EventsMit 51 Prozent verzeichnet die Brain City Berlin die höchste Quote an Hochschul-Erstabsolventinnen und -absolventen in Deutschland.→Studienerstabschlüsse: Berlin 2023 bundesweit in Spitzenposition
-
Facts & Events
 © LNDW/Matthias Frank
Facts & Events200 Jahre Museumsinsel, 100 Jahre Quantenwissenschaft, 50 Jahre UdK Berlin, 25 Jahre LNDW: 2025 feiert die Brain City Berlin gleich mehrere Jubiläen.→
© LNDW/Matthias Frank
Facts & Events200 Jahre Museumsinsel, 100 Jahre Quantenwissenschaft, 50 Jahre UdK Berlin, 25 Jahre LNDW: 2025 feiert die Brain City Berlin gleich mehrere Jubiläen.→Brain City Berlin 2025: unsere Top-10
-
Facts & Events
 ©Mario Gogh/Unsplash
Facts & EventsGründungen aus Berliner Hochschulen heraus haben eine große Bedeutung für die Wirtschaft in der Region. Wie die hochschulübergreifende…→
©Mario Gogh/Unsplash
Facts & EventsGründungen aus Berliner Hochschulen heraus haben eine große Bedeutung für die Wirtschaft in der Region. Wie die hochschulübergreifende…→Hochschul-Start-ups stärken Berliner Wirtschaft
-
Facts & Events
 Berlin Science Week
Facts & EventsMit mehr als 200 Veranstaltungen und über 500 Vortragenden ist die diesjährige Berlin Science Week größer als jemals zuvor. Allerdings ist das…→
Berlin Science Week
Facts & EventsMit mehr als 200 Veranstaltungen und über 500 Vortragenden ist die diesjährige Berlin Science Week größer als jemals zuvor. Allerdings ist das…→Berlin Science Week 2020 – digital und global
-
Facts & Events
 ©TU Berlin Pressestelle / Dahl
Facts & EventsDie Corona-Pandemie birgt viele Risiken – für Einzelne, aber auch für die Gesellschaft. Doch wie werden die Risiken wahrgenommen? Und wie passen…→
©TU Berlin Pressestelle / Dahl
Facts & EventsDie Corona-Pandemie birgt viele Risiken – für Einzelne, aber auch für die Gesellschaft. Doch wie werden die Risiken wahrgenommen? Und wie passen…→Risikowahrnehmung in der Corona-Krise – Umfrage der TU Berlin
-
Facts & Events
 ©Agentur Medienlabor/Adam Sevens
Facts & EventsGesucht werden wieder Produkte, Konzepte und Lösungen, die beispielhaft für die Innnovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion…→
©Agentur Medienlabor/Adam Sevens
Facts & EventsGesucht werden wieder Produkte, Konzepte und Lösungen, die beispielhaft für die Innnovationsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion…→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2022: bis 4. Juli bewerben
-
Facts & Events
 © Pelin Asa, Matters of Activity / Max Planck Institute of Colloids and Interfaces
Facts & EventsDie Ausstellungen „Symbiotic Wood“ und „Swamp Things!“ des Exzellenzcluster „Matters of Activity“ betrachten Käferfraß, Pilzbefall und scheinbar…→
© Pelin Asa, Matters of Activity / Max Planck Institute of Colloids and Interfaces
Facts & EventsDie Ausstellungen „Symbiotic Wood“ und „Swamp Things!“ des Exzellenzcluster „Matters of Activity“ betrachten Käferfraß, Pilzbefall und scheinbar…→Inspiriert von Käfern und Moorpflanzen
-
Transfer – Stories
 ©ESCP EUROPE
Transfer – Stories29.10.2019 | Prof. Dr. Andreas Kaplan ist Brain City Berlin-Botschafter und Rektor der ESCP Europe Business School Berlin. In seiner Forschung…→
©ESCP EUROPE
Transfer – Stories29.10.2019 | Prof. Dr. Andreas Kaplan ist Brain City Berlin-Botschafter und Rektor der ESCP Europe Business School Berlin. In seiner Forschung…→„Wir müssen es schaffen, jeden auf die Reise mitzunehmen“
-
Facts & Events
 ©ADN Broadcast
Facts & Events31.10.2019 | Bereits zum zweiten Mal fand am 21. September 2019 ein Falling Walls Lab im nordafrikanischen Tunis statt. Organisiert wurde das Event,…→
©ADN Broadcast
Facts & Events31.10.2019 | Bereits zum zweiten Mal fand am 21. September 2019 ein Falling Walls Lab im nordafrikanischen Tunis statt. Organisiert wurde das Event,…→Brain City Botschafterin organisiert 2. Falling Walls Lab in Tunis
-
Facts & Events
 LNDW/Irmisch
Facts & EventsDie Lange Nacht der Wissenschaften ist jedes Jahr im Juni eines der Highlights im Eventkalender der Brain City Berlin. In diesem Jahr ist alles…→
LNDW/Irmisch
Facts & EventsDie Lange Nacht der Wissenschaften ist jedes Jahr im Juni eines der Highlights im Eventkalender der Brain City Berlin. In diesem Jahr ist alles…→Lange Nacht der Wissenschaften – in diesem Jahr als Podcast-Reihe
-
Transfer – Stories
 Fotocredit: Ortner & Ortner / Siemens
Transfer – StoriesSiemensstadt 2.0 ist ein Ort der Zukunft. Bis 2030 soll auf dem historischen Firmengelände im Nordwesten der Brain City ein moderner, weltoffener…→
Fotocredit: Ortner & Ortner / Siemens
Transfer – StoriesSiemensstadt 2.0 ist ein Ort der Zukunft. Bis 2030 soll auf dem historischen Firmengelände im Nordwesten der Brain City ein moderner, weltoffener…→Siemensstadt 2.0: Forschung und Industrie eng verknüpft
-
Facts & Events Transfer – Stories
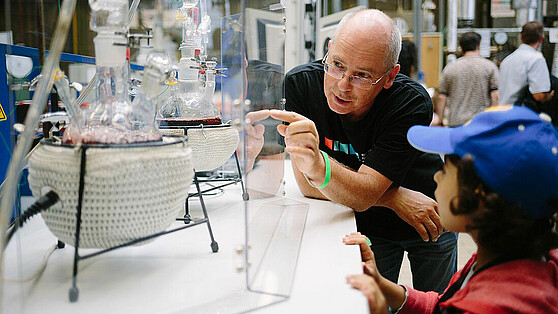 © BHT/Zarko Martovic
Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→
© BHT/Zarko Martovic
Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→Lange Nacht der Wissenschaften 2023
-
Facts & Events
 ©TU Berlin Pressestelle
Facts & Events„Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data“ (BIFOLD) heißt das neue Konstrukt für KI-Spitzenforschung, welches das Berlin Big Data…→
©TU Berlin Pressestelle
Facts & Events„Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data“ (BIFOLD) heißt das neue Konstrukt für KI-Spitzenforschung, welches das Berlin Big Data…→KI-Leuchtturm für Berlin: Millionenförderung durch Bund und Land
-
Talent
 Dr. Sana Amairi Pyka | Falling Walls Lab Tunis
TalentBrain City Berlin im Interview mit Dr. Sana Amairi Pyka, die das erste Falling Walls Lab in Tunis veranstaltet hat. Der Sieger wird am 8. November am…→
Dr. Sana Amairi Pyka | Falling Walls Lab Tunis
TalentBrain City Berlin im Interview mit Dr. Sana Amairi Pyka, die das erste Falling Walls Lab in Tunis veranstaltet hat. Der Sieger wird am 8. November am…→Brain City Botschafterin organisiert Falling Walls Lab in Tunis | 07.11.2018
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Berlin Partner / eventfotografen.berlin
Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→
© Berlin Partner / eventfotografen.berlin
Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→UNITE Sciences: Technologietransfer beschleunigen
-
Startup Transfer – Stories
 © STOFF2/Kerstin Reisch
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up STOFF2 will die „Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse“ (ZZE) zur Marktreife bringen und arbeitet dabei auch eng mit der Technischen…→
© STOFF2/Kerstin Reisch
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up STOFF2 will die „Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse“ (ZZE) zur Marktreife bringen und arbeitet dabei auch eng mit der Technischen…→Der kleine, feine Zwischenschritt
-
Facts & Events
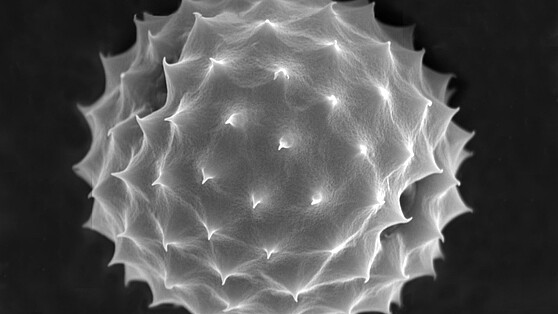 © ZAUM / Christine Weil
Facts & EventsEine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat eine App entwickelt, mit der sich der Pollenflug auf drei Stunden genau…→
© ZAUM / Christine Weil
Facts & EventsEine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat eine App entwickelt, mit der sich der Pollenflug auf drei Stunden genau…→Charité-App „Pollenius“: Citizen Science & Daten aus der Pollenfalle
-
Facts & Events
 HU Berlin/Matthias Heyde
Facts & EventsForschung über Wimmelbilder entschlüsseln: Die Humboldt-Universität zu Berlin bietet seit März geführte Touren durch den „Bahnhof der Wissenschaften…→
HU Berlin/Matthias Heyde
Facts & EventsForschung über Wimmelbilder entschlüsseln: Die Humboldt-Universität zu Berlin bietet seit März geführte Touren durch den „Bahnhof der Wissenschaften…→Ausstellungs-Tipp: Wissenschafts-Tour im Untergrund
-
Facts & Events
 Bild von Fionn Grosse via Unsplash
Facts & EventsStadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?→
Bild von Fionn Grosse via Unsplash
Facts & EventsStadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?→Stadtentwicklungskongress 2026: Welche Visionen treiben die Städte von morgen an?
-
Facts & Events
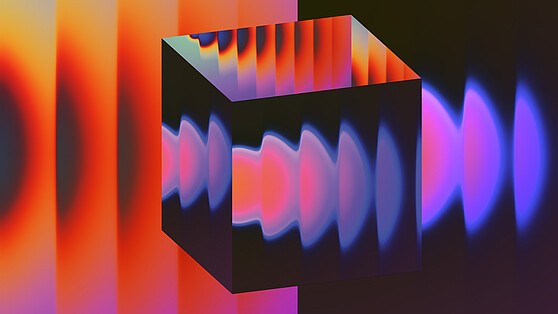 Berlin Science Week 2025 © Design: Bjoern Wolf / Graphic: Martin Naumann
Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November lädt die Berlin Science Week wieder dazu ein, die Brain City Berlin zu erkunden. Das diesjährige Motto „Beyond Now“.→
Berlin Science Week 2025 © Design: Bjoern Wolf / Graphic: Martin Naumann
Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November lädt die Berlin Science Week wieder dazu ein, die Brain City Berlin zu erkunden. Das diesjährige Motto „Beyond Now“.→Neue Perspektiven eröffnen: Berlin Science Week 2025
-
Facts & Events
 ©Marcel/Unsplash
Facts & EventsOb Großes Mausohr, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus oder Großer Abendsegler – Fledermäuse fühlen sich in Berlin besonders wohl. Von 25 in…→
©Marcel/Unsplash
Facts & EventsOb Großes Mausohr, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus oder Großer Abendsegler – Fledermäuse fühlen sich in Berlin besonders wohl. Von 25 in…→Bis zum 8. März bewerben: Fledermaus-Hauptstadt sucht Hobbyforscher
-
Facts & Events
 shutterstock.com©NicoEINino
Facts & EventsIm Projekt „OpinionGPT" untersuchen Forschende der HU Berlin, wie sich vorurteilsgeprägte Trainingsdaten auf die Antworten von Künstlicher Intelligenz…→
shutterstock.com©NicoEINino
Facts & EventsIm Projekt „OpinionGPT" untersuchen Forschende der HU Berlin, wie sich vorurteilsgeprägte Trainingsdaten auf die Antworten von Künstlicher Intelligenz…→Bewusst voreingenommen
-
Facts & Events
 © Berlin University Alliance / Matthias Heyde
Facts & EventsDie Entscheidung ist gefallen: Die Brain City Berlin geht mit fünf Forschungs-Clustern in die nächste Runde der Exzellenzförderung von Bund und…→
© Berlin University Alliance / Matthias Heyde
Facts & EventsDie Entscheidung ist gefallen: Die Brain City Berlin geht mit fünf Forschungs-Clustern in die nächste Runde der Exzellenzförderung von Bund und…→Exzellenzstrategie: Berlin künftig mit 5 Clustern dabei
-
Transfer – Stories
 EUREF AG©Gasometertour.de
Transfer – StoriesAuf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft an klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Lösungen für…→
EUREF AG©Gasometertour.de
Transfer – StoriesAuf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft an klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Lösungen für…→Energiewende zum Anfassen
-
Facts & Events
 © ESMT Berlin/Fotografin: Annette Korrol
Facts & EventsSchöner Erfolg auch für die Brain City Berlin: Özlem Bedre-Defolie, Associate Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der internationalen…→
© ESMT Berlin/Fotografin: Annette Korrol
Facts & EventsSchöner Erfolg auch für die Brain City Berlin: Özlem Bedre-Defolie, Associate Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der internationalen…→Dominanten Plattformen auf der Spur: ESMT-Professorin erhält rund 1,5 Millionen Euro Förderung | 11.09.2019
-
Facts & Events
 © SPB/Natalie Toczek
Facts & Events100 Jahre Planetarium: Am 21. Oktober feiert das Berliner Zeiss-Großplanetarium das Sternenschau-Jubiläum mit einem bunten Programm aus Astronomie,…→
© SPB/Natalie Toczek
Facts & Events100 Jahre Planetarium: Am 21. Oktober feiert das Berliner Zeiss-Großplanetarium das Sternenschau-Jubiläum mit einem bunten Programm aus Astronomie,…→Umsonst ins All reisen
-
Facts & Events
 © HTW Berlin/Chris Hartung
Facts & EventsVom 30. Mai bis 3. Juni 2022 können sich Schulabsolventinnen auf der Berliner Woche der Studienorientierung umfassend über die Studienangebote an den…→
© HTW Berlin/Chris Hartung
Facts & EventsVom 30. Mai bis 3. Juni 2022 können sich Schulabsolventinnen auf der Berliner Woche der Studienorientierung umfassend über die Studienangebote an den…→Berliner Woche der Studienorientierung
-
Insights Transfer – Stories
 © edelVIZ
Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→
© edelVIZ
Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→Think Tank für die Ernährung der Zukunft
-
Facts & Events
 © Berlin Partner / Elvina Kulinicenko
Facts & EventsIm Oktober/November fiel der Startschuss für den Bau von gleich drei prominenten Forschungsgebäuden in Berlin, ein weiteres wurde eröffnet. Ein…→
© Berlin Partner / Elvina Kulinicenko
Facts & EventsIm Oktober/November fiel der Startschuss für den Bau von gleich drei prominenten Forschungsgebäuden in Berlin, ein weiteres wurde eröffnet. Ein…→Schaufenster, Hubs und Innovationsplattformen: Was ist neu in der Brain City Berlin?
-
Facts & Events
 ©Samuel Henne
Facts & EventsDie Ausstellung MACHT NATUR im Berliner STATE Studio thematisiert das Unbehagen, das viele von uns angesichts des Eingriffs des Menschen in die Natur…→
©Samuel Henne
Facts & EventsDie Ausstellung MACHT NATUR im Berliner STATE Studio thematisiert das Unbehagen, das viele von uns angesichts des Eingriffs des Menschen in die Natur…→MACHT NATUR – eine Ausstellung, die Fragen stellt
-
Talent Facts & Events
 © WISTA Management GmbH
Talent Facts & EventsDissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz.→
© WISTA Management GmbH
Talent Facts & EventsDissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz.→Dissertationspreis Adlershof 2025 geht an Nachwuchswissenschaftler Dr. Sascha Robert Gaudlitz
-
Insights
 © WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner
InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→
© WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner
InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→Blaupause für Zukunft
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→
© Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→
Science Community. Interview mit Festival-Leiterin…Wissenschaft für den Dialog mit der Gesellschaft öffnen
-
Facts & Events
 © Berlin University Alliance
Facts & EventsAb dem 10. Oktober 2025 präsentiert die Ausstellung „On Water. WasserWissen in Berlin“ im Humboldt Labor ganz neue Perspektiven auf das Element…→
© Berlin University Alliance
Facts & EventsAb dem 10. Oktober 2025 präsentiert die Ausstellung „On Water. WasserWissen in Berlin“ im Humboldt Labor ganz neue Perspektiven auf das Element…→„On Water“: Wasser neu denken
-
Facts & Events
 LNDW / Freie Universität Berlin © Rolf Schulten
Facts & EventsFreiheit, Zeit oder Wissenstransfer – auch 2024 stehen im Veranstaltungskalender der Brain City Berlin wieder viele spannende Themen und Events.→
LNDW / Freie Universität Berlin © Rolf Schulten
Facts & EventsFreiheit, Zeit oder Wissenstransfer – auch 2024 stehen im Veranstaltungskalender der Brain City Berlin wieder viele spannende Themen und Events.→Brain City Berlin 2024: unsere Top-10
-
Insights
 © Ernestine von der Osten-Sacken
InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→
© Ernestine von der Osten-Sacken
InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→Weihnachtsessen: bitte keine Überraschungen!
-
Facts & Events
 ©Fotowerk – AdobeStock
Facts & EventsGleich drei neue Gesundheitsstudiengänge starten zum Wintersemester 2020/21 an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin).→
©Fotowerk – AdobeStock
Facts & EventsGleich drei neue Gesundheitsstudiengänge starten zum Wintersemester 2020/21 an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin).→Jetzt bewerben: 3 neue Gesundheitsstudiengänge an der ASH Berlin
-
Transfer – Stories
 Anna Raysyan privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Anna Raysyan lebt seit 3,5 Jahren in Berlin. Sie ist Doktorandin an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung…→
Anna Raysyan privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Anna Raysyan lebt seit 3,5 Jahren in Berlin. Sie ist Doktorandin an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung…→Gastbeitrag: „Berlin mag die Mutigen!"
-
Transfer – Stories
 Adi Goldstein auf Unsplash
Transfer – StoriesDie StadtManufaktur Berlin vereint Forschungsprojekte der TU Berlin unter einem Dach. Langfristiges Ziel dieser „offenen Laborsituation“: die Brain…→
Adi Goldstein auf Unsplash
Transfer – StoriesDie StadtManufaktur Berlin vereint Forschungsprojekte der TU Berlin unter einem Dach. Langfristiges Ziel dieser „offenen Laborsituation“: die Brain…→Wissenschaft im Austausch mit der Stadt
-
Startup Transfer – Stories
 © Quantistry
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up Quantistry ermöglicht chemische Experimente im digitalen Raum mithilfe Künstlicher Intelligenz und quantenchemischer…→
© Quantistry
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up Quantistry ermöglicht chemische Experimente im digitalen Raum mithilfe Künstlicher Intelligenz und quantenchemischer…→Das Chemielabor in der Wolke
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © HTW/ZfS
Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→
© HTW/ZfS
Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→Ideen für Berlins Zukunft
-
Facts & Events
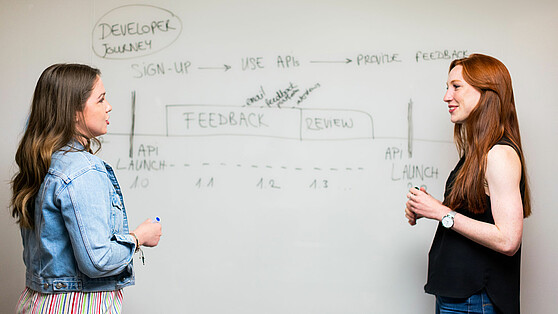 Credit: ThisisEngeneering RAEng on Unsplash
Facts & EventsEs gilt als eines der wichtigsten Instrumente der Berliner Hochschulgleichstellungspolitk: Das „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit…→
Credit: ThisisEngeneering RAEng on Unsplash
Facts & EventsEs gilt als eines der wichtigsten Instrumente der Berliner Hochschulgleichstellungspolitk: Das „Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit…→Berliner Chancengleichheitsprogramm verlängert
-
Insights Transfer – Stories Innovationen
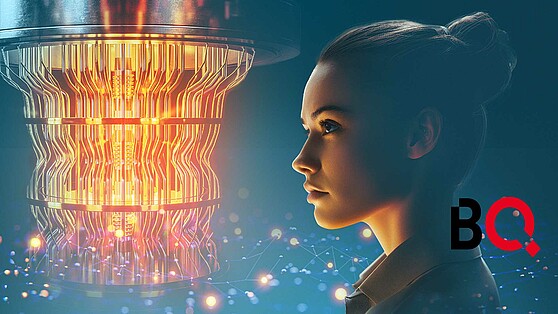 © Berlin Partner
Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→
© Berlin Partner
Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→BERLIN QUANTUM: neue Initiative für Quantentechnologien
-
Transfer – Stories
 (V.li.n.re.) Prof. Christian Matzdorf, Polizeikommissar Turgay Akkaya, Stefan Graf Finck von Finckenstein, Foto: HWR Berlin / Sylke Schumann
Transfer – StoriesPolizeikommissar Turgay Akkaya hat im Rahmen seines Bachelor-Projekts an der HWR Berlin eine Anti-Stalking-App entwickelt. Für den hohen Praxisbezug…→
(V.li.n.re.) Prof. Christian Matzdorf, Polizeikommissar Turgay Akkaya, Stefan Graf Finck von Finckenstein, Foto: HWR Berlin / Sylke Schumann
Transfer – StoriesPolizeikommissar Turgay Akkaya hat im Rahmen seines Bachelor-Projekts an der HWR Berlin eine Anti-Stalking-App entwickelt. Für den hohen Praxisbezug…→Eine präventive App gegen Stalking
-
Facts & Events
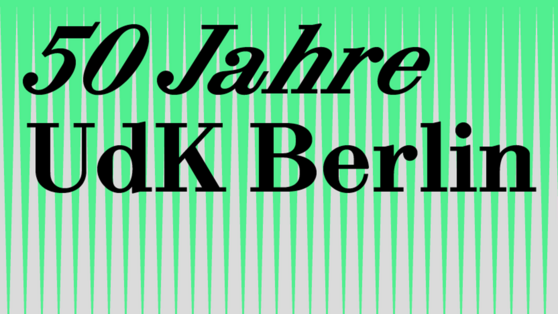 © UdK Berlin / Design: Ira Göller und Sophie Pischel
Facts & EventsAm 8. Februar startet die Universität der Künste Berlin in ihr Jubiläumsjahr. Mit fachbereichsübergreifenden Performances, Tanz, Theater,…→
© UdK Berlin / Design: Ira Göller und Sophie Pischel
Facts & EventsAm 8. Februar startet die Universität der Künste Berlin in ihr Jubiläumsjahr. Mit fachbereichsübergreifenden Performances, Tanz, Theater,…→50 Jahre: UdK Berlin feiert Vielfalt ihrer Disziplinen
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Transfer Week
Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→
© Transfer Week
Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→Impulse setzen für Kooperationen: Transfer Week 2022
-
Insights Facts & Events
 © Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Facts & EventsEs geht um die Ernährung der Zukunft: Im Verbundprojekt CUBES Circle erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie etablierte…→
© Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Facts & EventsEs geht um die Ernährung der Zukunft: Im Verbundprojekt CUBES Circle erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie etablierte…→Tomaten und Fische im Zero-Waste-Kreislauf
-
Facts & Events
 Foto: LAGeSo/Dirk Laessig
Facts & EventsDie Preisträger:innen sind: Caroline Frädrich und Prof. Dr. Josef Köhrle vom Institut für Experimentelle Endokrinologie der Charité –…→
Foto: LAGeSo/Dirk Laessig
Facts & EventsDie Preisträger:innen sind: Caroline Frädrich und Prof. Dr. Josef Köhrle vom Institut für Experimentelle Endokrinologie der Charité –…→„Berliner Forschungspreis für Alternativen zu Tierversuchen“: Projekt von Charité und BfR gewinnt
-
 shutterstock © Konstantin Yuganov
Beim Shoppen im Netz die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten, ist nicht einfach. Der KI-basierte Green Consumption Assistant soll Konsumentinnen und…→
shutterstock © Konstantin Yuganov
Beim Shoppen im Netz die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten, ist nicht einfach. Der KI-basierte Green Consumption Assistant soll Konsumentinnen und…→Grüne Produktempfehlungen per KI
-
Facts & Events
 ©Futurium/David von Becker
Facts & EventsDie Zukunft beschäftigt wohl jeden von uns, denn die Zukunft geht uns alle an. Im gestern in der Brain City Berlin eröffneten Futurium kann sich jeder…→
©Futurium/David von Becker
Facts & EventsDie Zukunft beschäftigt wohl jeden von uns, denn die Zukunft geht uns alle an. Im gestern in der Brain City Berlin eröffneten Futurium kann sich jeder…→Öffentlicher Denkraum in der Brain City Berlin: Futurium eröffnet | 06.09.2019
-
Insights Transfer – Stories
 © LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan
Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→
© LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan
Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→Garten-Kunst aus der Insektenperspektive
-
Facts & Events
 SOWG © Sarah Rauch/LOC
Facts & Events#ZusammenUnschlagbar: Vom 17. bis zum 25. Juni finden in der Sportmetropole Berlin die Special Olympics World Games 2023 statt. Auch…→
SOWG © Sarah Rauch/LOC
Facts & Events#ZusammenUnschlagbar: Vom 17. bis zum 25. Juni finden in der Sportmetropole Berlin die Special Olympics World Games 2023 statt. Auch…→Als Forscher:in zu den Special Olympics World Games
-
Transfer – Stories
 © AW Creative on Unsplash
Transfer – StoriesDas Studium oder eine Lehr- bzw. Forschungstätigkeit mit der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen zu vereinbaren, ist keine leichte…→
© AW Creative on Unsplash
Transfer – StoriesDas Studium oder eine Lehr- bzw. Forschungstätigkeit mit der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen zu vereinbaren, ist keine leichte…→Von der Tierparkschule bis zum Mutterschutz – familienfreundliche Hochschulen
-
Insights Transfer – Stories
 © Kai Müller Photography
Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→
© Kai Müller Photography
Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→airpuls: 5-G-Lösungen aus der Forschung
-
Transfer – Stories
 Foto: Ernestine von der Osten-Sacken (vdo)
Transfer – StoriesIm Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC sitzen rund 50 Start-ups. Die Vernetzung am Standort ist ausgesprochen gut, denn das CHIC gehört zu einem…→
Foto: Ernestine von der Osten-Sacken (vdo)
Transfer – StoriesIm Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC sitzen rund 50 Start-ups. Die Vernetzung am Standort ist ausgesprochen gut, denn das CHIC gehört zu einem…→CHIC – Gründungszentrum am Zukunftsort
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin Partner
Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→
© Berlin Partner
Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→AMBER: Vernetzung von Spitzenforschung und Industrie
-
Facts & Events
 Matthias Heyde, HU Berlin
Facts & EventsWissenschaftlich wimmelt es derzeit im neuen U-Bahnhof Unter den Linden. Eine Ausstellung der Humboldt-Universität zu Berlin zeigt Suchbilder zu…→
Matthias Heyde, HU Berlin
Facts & EventsWissenschaftlich wimmelt es derzeit im neuen U-Bahnhof Unter den Linden. Eine Ausstellung der Humboldt-Universität zu Berlin zeigt Suchbilder zu…→Ausstellungs-Tipp: Wissenschaft im Untergrund
-
Facts & Events
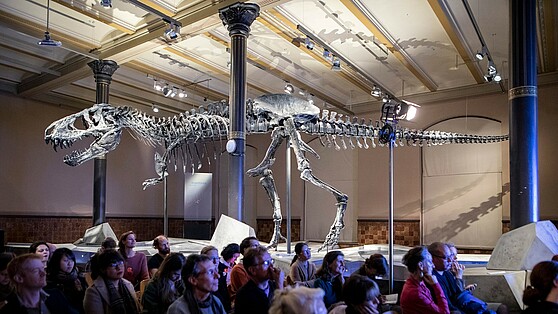 © Falling Walls Foundation
Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften oder Greentech Festival – das Berliner Wissenschaftsjahr 2020 verspricht mindestens so spannend…→
© Falling Walls Foundation
Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften oder Greentech Festival – das Berliner Wissenschaftsjahr 2020 verspricht mindestens so spannend…→Brain City Berlin 2020: 10 Event-Highlights
-
Facts & Events
 © Christop Sapp (denXte)
Facts & EventsProf. Dr. Barbara Vetter von der FU Berlin und Prof. Dr. Klaus-Robert Müller von der TU Berlin erhalten den wichtigsten deutschen…→
© Christop Sapp (denXte)
Facts & EventsProf. Dr. Barbara Vetter von der FU Berlin und Prof. Dr. Klaus-Robert Müller von der TU Berlin erhalten den wichtigsten deutschen…→Leibniz-Preise für Philosophin und Informatiker aus Berlin
-
Transfer – Stories
 Foto: Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Transfer – StoriesDer Campus Berlin-Buch im Norden der Brain City Berlin entwickelt sich zu einem der größten Wirtschafts- und Forschungsstandorte für Life Sciences in…→
Foto: Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Transfer – StoriesDer Campus Berlin-Buch im Norden der Brain City Berlin entwickelt sich zu einem der größten Wirtschafts- und Forschungsstandorte für Life Sciences in…→Lebendiges Gesundheitsnetzwerk
-
Transfer – Stories
 HIIG
Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Forschungsdirektor im Bereich „Internet und Medienregulierung“ am Alexander von Humboldt Institut…→
HIIG
Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Forschungsdirektor im Bereich „Internet und Medienregulierung“ am Alexander von Humboldt Institut…→„Ein nachhaltiges Ziel unserer Arbeit ist es, zu verdeutlichen, was die Technik eigentlich kann“
-
Facts & Events Transfer – Stories
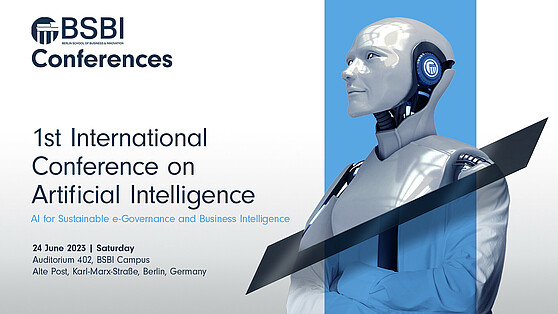 © BSBI
Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→
© BSBI
Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→KI-Konferenz an der Berlin School of Business & Innovation
-
Transfer – Stories
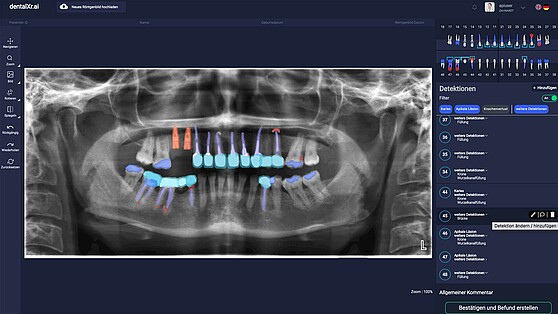 dentalXr.ai
Transfer – StoriesdentalXrai ist das erste zahnmedizinische Start-up, das sich aus der Charité heraus gegründet hat. Auf den Weg gebracht wurde es über den Accelerator…→
dentalXr.ai
Transfer – StoriesdentalXrai ist das erste zahnmedizinische Start-up, das sich aus der Charité heraus gegründet hat. Auf den Weg gebracht wurde es über den Accelerator…→Mit künstlicher Intelligenz gegen Karies & Co.
-
Transfer – Stories
 Foto: Christina Lüdtke privat
Transfer – StoriesVier Universitäten, ein Verbund: Das Netzwerk „Science & Startups“ bündelt die Gründungs-Services der in der Berlin University Alliance vereinten…→
Foto: Christina Lüdtke privat
Transfer – StoriesVier Universitäten, ein Verbund: Das Netzwerk „Science & Startups“ bündelt die Gründungs-Services der in der Berlin University Alliance vereinten…→Breite Unterstützung für Hochschul-Start-ups
-
Facts & Events
 ©visitBerlin/Sarah Lindemann
Facts & EventsReallabore bringen Wissenschaftler*innen mit Akteur*innen aus der Praxis zusammen, um im experimentellen Umfeld Lösungen für die Fragen von morgen zu…→
©visitBerlin/Sarah Lindemann
Facts & EventsReallabore bringen Wissenschaftler*innen mit Akteur*innen aus der Praxis zusammen, um im experimentellen Umfeld Lösungen für die Fragen von morgen zu…→Ausstellung „StadtManufaktur Berlin" – Experimentieren für eine lebenswerte Metropole
-
Insights Transfer – Stories
 Shutterstock © optimarc
Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→
Shutterstock © optimarc
Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→Blick über den Tellerrand hinaus
-
Facts & Events
 © wörner traxler richter planungsgesellschaft mbH
Facts & EventsDie Charité – Universitätsmedizin Berlin und das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) bündeln ihre Kompetenzen. Bis 2028 soll in Nähe des Westhafens für…→
© wörner traxler richter planungsgesellschaft mbH
Facts & EventsDie Charité – Universitätsmedizin Berlin und das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) bündeln ihre Kompetenzen. Bis 2028 soll in Nähe des Westhafens für…→Neues Herzzentrum für Berlin
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→
© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→Neues DLR-Institut für Weltraumforschung
-
Facts & Events
 Foto: Futurium © David von Becker
Facts & EventsSommerferien – sechs Wochen, in denen wir die Brain City Berlin einmal ganz neu erkunden können. Und das nicht nur am Wannsee oder Müggelsee. Für…→
Foto: Futurium © David von Becker
Facts & EventsSommerferien – sechs Wochen, in denen wir die Brain City Berlin einmal ganz neu erkunden können. Und das nicht nur am Wannsee oder Müggelsee. Für…→5 Tipps für die Ferien
-
Facts & Events
 © WZB/David Ausserhofer
Facts & EventsDer Politikwissenschaftler Michael Zürn hat den Berliner Wissenschaftspreis 2021 erhalten. Der Nachwuchspreis ging an die Theologin Mira Sievers.→
© WZB/David Ausserhofer
Facts & EventsDer Politikwissenschaftler Michael Zürn hat den Berliner Wissenschaftspreis 2021 erhalten. Der Nachwuchspreis ging an die Theologin Mira Sievers.→Berliner Wissenschaftspreis 2021 für Michael Zürn
-
Facts & Events
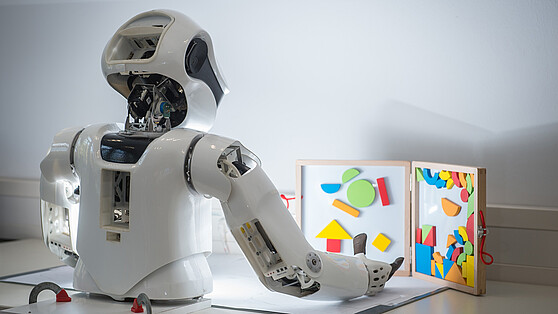 © BHT / Simone M. Neumann
Facts & EventsHier gleich drei aktuelle News, in denen unsere Brain City Botschafterinnen und Botschafter eine tragende Rolle spielen.→
© BHT / Simone M. Neumann
Facts & EventsHier gleich drei aktuelle News, in denen unsere Brain City Botschafterinnen und Botschafter eine tragende Rolle spielen.→UNITE und mehr: 3 x Neues
-
Transfer – Stories
 ©Credit Silke Oßwald/FMP
Transfer – StoriesProfessor Dr. Volker Haucke, Direktor am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Professor für Molekulare Pharmakologie an…→
©Credit Silke Oßwald/FMP
Transfer – StoriesProfessor Dr. Volker Haucke, Direktor am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Professor für Molekulare Pharmakologie an…→Im Spagat zwischen Detail und Gesamtkonzept
-
Transfer – Stories
 © Pocky Lee on Unsplash
Transfer – StoriesGeisterspiele vor leeren Rängen, virtuelle Marathons und Eventverschiebungen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spitzen- und Breitensport…→
© Pocky Lee on Unsplash
Transfer – StoriesGeisterspiele vor leeren Rängen, virtuelle Marathons und Eventverschiebungen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spitzen- und Breitensport…→„Jetzt schlägt die Stunde der Innovator*innen“
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→
© Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→Mit Fokus auf Kunst & Wissenschaft: Berlin Science Week 2023
-
Talent
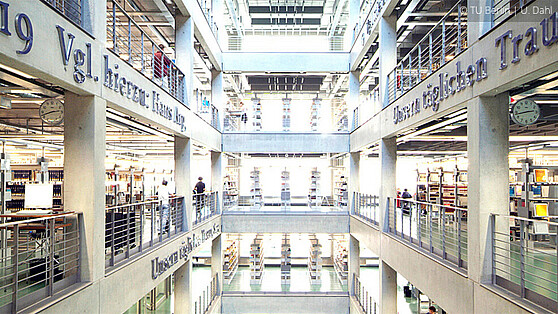 TU Berlin | U. Dahl
TalentDie Internationale Post-Doc Initiative der Technischen Universität Berlin richtet sich an Wissenschaftlerinnen aus aller Welt. Im Rahmen des TU…→
TU Berlin | U. Dahl
TalentDie Internationale Post-Doc Initiative der Technischen Universität Berlin richtet sich an Wissenschaftlerinnen aus aller Welt. Im Rahmen des TU…→IPODI – TU Berlin fördert internationale Wissenschaftlerinnen | 14.05.2018
-
Facts & Events
 © ASH Berlin
Facts & EventsDas neue Erweiterungsgebäude der ASH Berlin soll Platz für rund 1.700 Studierende und eine neue Mensa schaffen. Im Sommer 2024 soll das Gebäude fertig…→
© ASH Berlin
Facts & EventsDas neue Erweiterungsgebäude der ASH Berlin soll Platz für rund 1.700 Studierende und eine neue Mensa schaffen. Im Sommer 2024 soll das Gebäude fertig…→Alice Salomon Hochschule feiert Richtfest
-
Transfer – Stories
 ©Ivar Veermäe / Centre for Entrepreneurship
Transfer – StoriesUm herauszufinden, welche wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftsbasierte Ausgründungen für Berlin und Brandenburg haben, führen insgesamt zehn…→
©Ivar Veermäe / Centre for Entrepreneurship
Transfer – StoriesUm herauszufinden, welche wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftsbasierte Ausgründungen für Berlin und Brandenburg haben, führen insgesamt zehn…→„Vor allem die Gesellschaft profitiert von Hightech-Start-ups“– Gründungsumfrage der Hochschulen geht in die dritte Runde
-
Insights Transfer – Stories
 © Stefan Schostok
Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→
© Stefan Schostok
Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→Angehörigen von Strafgefangenen eine wissenschaftliche Stimme verleihen
-
Facts & Events
 ©Syda Productions7stock.adobe.com
Facts & EventsDie Hochschulen der Brain City Berlin kehren zum Präsenzunterricht zurück. Das haben die Berliner Hochschulen und die Senatsverwaltung für…→
©Syda Productions7stock.adobe.com
Facts & EventsDie Hochschulen der Brain City Berlin kehren zum Präsenzunterricht zurück. Das haben die Berliner Hochschulen und die Senatsverwaltung für…→Der Campus wird wieder lebendig
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin Partner/Wüstenhagen
Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→
© Berlin Partner/Wüstenhagen
Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→Brain City Berlin launcht neue Kampagnenmotive
-
Facts & Events
 FU Berlin © Stephan Niespodziany, www.rejoyce.berlin
Facts & EventsDigital, hybrid oder live vor Ort – es wird auf jeden Fall spannend! Wir haben die Highlights für Sie zusammengestellt.→
FU Berlin © Stephan Niespodziany, www.rejoyce.berlin
Facts & EventsDigital, hybrid oder live vor Ort – es wird auf jeden Fall spannend! Wir haben die Highlights für Sie zusammengestellt.→Brain City Berlin 2021: die Top-10 Events
-
Insights Transfer – Stories
 © ASH Berlin/Cristián Pérez
Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→
© ASH Berlin/Cristián Pérez
Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→SAGE – ein soziales Dreier-Bündnis
-
Insights Transfer – Stories
 @ Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→
@ Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→Mit den Ohren sehen
-
Insights Transfer – Stories
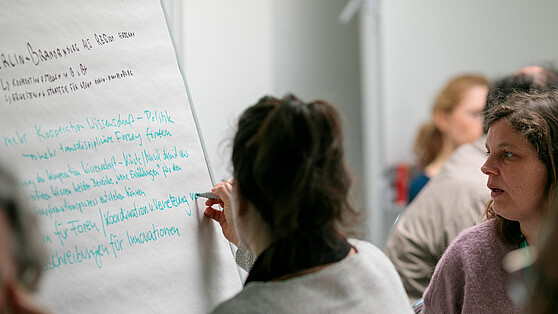 CCC © Michael Reinhardt
Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→
CCC © Michael Reinhardt
Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→„Klimatransformation ist ein Marathon“
-
Facts & Events
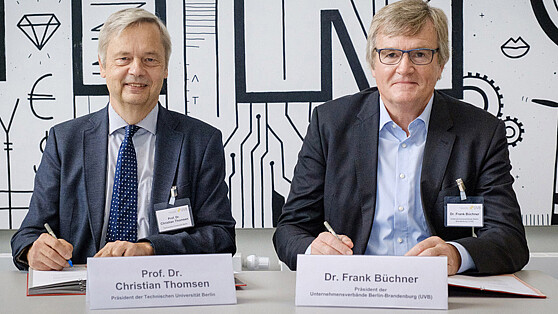 UVB 2019 / André Wagenzik
Facts & EventsDie Brain City Berlin gilt bundesweit als einer der wichtigsten Standorte für Künstliche Intelligenz. Um den Technologietransfer zwischen Wissenschaft…→
UVB 2019 / André Wagenzik
Facts & EventsDie Brain City Berlin gilt bundesweit als einer der wichtigsten Standorte für Künstliche Intelligenz. Um den Technologietransfer zwischen Wissenschaft…→Den Digitalen Wandel beschleunigen: TU Berlin und Unternehmensverbände intensivieren Kooperation | 02.10.2019
-
Transfer – Stories
 Foto: "Lucid Dream", Elena Kunau und Mariya Yordanova
Transfer – StoriesARTIFICIAL REALITY – VIRTUAL INTELLIGENCE heißt die Ausstellung, die vom 8. bis 12. September im Rahmen des Ars Electronica Garden Berlin zu sehen…→
Foto: "Lucid Dream", Elena Kunau und Mariya Yordanova
Transfer – StoriesARTIFICIAL REALITY – VIRTUAL INTELLIGENCE heißt die Ausstellung, die vom 8. bis 12. September im Rahmen des Ars Electronica Garden Berlin zu sehen…→Interaktion durch Emotion
-
Facts & Events
 Foto: Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog
Facts & EventsLeinen los! Vom 3. bis 8. Mai ankert die MS Wissenschaft in der Brain City Berlin. Anschließend startet das schwimmende Science Center wieder auf…→
Foto: Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog
Facts & EventsLeinen los! Vom 3. bis 8. Mai ankert die MS Wissenschaft in der Brain City Berlin. Anschließend startet das schwimmende Science Center wieder auf…→Ausstellungs-Tipp: MS Wissenschaft in Berlin
-
 Credit: Campus Berlin-Buch/Patrick Meinhold
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltungen für die Lange Nacht der Wissenschaften 2021 abgesagt werden.…→
Credit: Campus Berlin-Buch/Patrick Meinhold
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltungen für die Lange Nacht der Wissenschaften 2021 abgesagt werden.…→130 digitale Aha-Momente aus der Brain City Berlin
-
 Wissen/Wissenschaft im Dialog/Chris Lawton
Bürgerforscher*innen aufgepasst: Am 14. und 15. Oktober 2020 lädt das Citizen-Science-Festival in der Berliner Kulturbrauerei Kinder, Jugendliche und…→
Wissen/Wissenschaft im Dialog/Chris Lawton
Bürgerforscher*innen aufgepasst: Am 14. und 15. Oktober 2020 lädt das Citizen-Science-Festival in der Berliner Kulturbrauerei Kinder, Jugendliche und…→Ferien-Tipp: Mitforschen! auf dem Citizen-Science-Festival
-
Insights
 Foto: privat
InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→
Foto: privat
InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→New Work – neue Arbeitskonzepte für zukunftsfähige Unternehmenskulturen
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © CeRRI 2024
Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→
© CeRRI 2024
Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→„Transfer 1000“: Studie zum Wissenschaftstransfer
-
Facts & Events
 LNDM: Kulturprojekte © Christian Kielmann
Facts & EventsLangeweile in den Ferien? Die Brain City Berlin bietet jede Menge Abwechslung! Hier unsere Ferien-Favoriten.→
LNDM: Kulturprojekte © Christian Kielmann
Facts & EventsLangeweile in den Ferien? Die Brain City Berlin bietet jede Menge Abwechslung! Hier unsere Ferien-Favoriten.→10 Tipps für den Sommer
-
Facts & Events
 ThisisEngineering RAEng on Unsplash
Facts & EventsBerliner Hochschulen liegen in puncto Gleichstellung über dem bundesweiten Schnitt. 2020 besetzten die staatlichen Hochschulen in der Brain City…→
ThisisEngineering RAEng on Unsplash
Facts & EventsBerliner Hochschulen liegen in puncto Gleichstellung über dem bundesweiten Schnitt. 2020 besetzten die staatlichen Hochschulen in der Brain City…→Hauptstadt der Professorinnen
-
Facts & Events
 Foto: Falling Walls Foundation
Facts & EventsVom 1. bis 10. November macht das internationale Festival Wissenschaft erlebbar. Mit 500 Sprecherinnen und Sprechern aus aller Welt und mehr als 200…→
Foto: Falling Walls Foundation
Facts & EventsVom 1. bis 10. November macht das internationale Festival Wissenschaft erlebbar. Mit 500 Sprecherinnen und Sprechern aus aller Welt und mehr als 200…→Berlin Science Week 2021: viele spannende Highlights
-
Transfer – Stories
 Berlin University Alliance/Matthias Heyde
Transfer – StoriesGemeinsam ist man stärker. Und auch erfolgreicher. Als „Berlin University Alliance“ bewarben sich die Technische Universität Berlin, die Freie…→
Berlin University Alliance/Matthias Heyde
Transfer – StoriesGemeinsam ist man stärker. Und auch erfolgreicher. Als „Berlin University Alliance“ bewarben sich die Technische Universität Berlin, die Freie…→Herzlichen Glückwunsch: „Berlin University Alliance“ erhält Exzellenzförderung |19.07.2019
-
Transfer – Stories
 Credt: Startup Incubator Berlin
Transfer – StoriesDer Startup Incubator Berlin (SIB) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin bringt Gründer-Teams besonders erfolgreich an den Start – wie die…→
Credt: Startup Incubator Berlin
Transfer – StoriesDer Startup Incubator Berlin (SIB) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin bringt Gründer-Teams besonders erfolgreich an den Start – wie die…→„Wir bringen Ideen an den Markt“
-
Transfer – Stories
 Tim Landgraf
Transfer – StoriesDie Brain City Berlin gilt als einer der führenden Standorte für Künstliche Intelligenz in Deutschland. An zahlreichen Instituten, Universitäten und…→
Tim Landgraf
Transfer – StoriesDie Brain City Berlin gilt als einer der führenden Standorte für Künstliche Intelligenz in Deutschland. An zahlreichen Instituten, Universitäten und…→Von Fischen, Bienen und selbstfahrenden Autos | 07.06.2019
-
Transfer – Stories
 Franziska Sattler
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafterin Franziska Sattler über ihre Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch mit Wissenschaft“ im Museum für Naturkunde…→
Franziska Sattler
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafterin Franziska Sattler über ihre Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch mit Wissenschaft“ im Museum für Naturkunde…→„Die Wissenschaft braucht das Vertrauen der Gesellschaft“
-
Facts & Events
 ©Marvin Meyer/Unsplash
Facts & EventsSo viele Studierende wie noch nie werden voraussichtlich zum Wintersemester 2019/20 an den Hochschulen und Universitäten der Brain City Berlin…→
©Marvin Meyer/Unsplash
Facts & EventsSo viele Studierende wie noch nie werden voraussichtlich zum Wintersemester 2019/20 an den Hochschulen und Universitäten der Brain City Berlin…→Semesterstart: 195.000 Studierende erwartet | 17.10.2019
-
Startup
 alvaro reyes on unsplash
StartupOb Kniffelspiel oder Sudoku – Gehirntraining gibt es bereits seit Jahrzehnten. Das Berliner Start-up NeuroNation bietet es per Web oder App. Das…→
alvaro reyes on unsplash
StartupOb Kniffelspiel oder Sudoku – Gehirntraining gibt es bereits seit Jahrzehnten. Das Berliner Start-up NeuroNation bietet es per Web oder App. Das…→Fitness-Training für das Hirn | 21.05.2019
-
Facts & Events
 © Futurium/Ali Ghandtschi
Facts & EventsFür all diejenigen, die für die Pfingstfeiertage noch nichts Konkretes geplant haben – hier ein paar Empfehlungen der Brain City-Redaktion, um…→
© Futurium/Ali Ghandtschi
Facts & EventsFür all diejenigen, die für die Pfingstfeiertage noch nichts Konkretes geplant haben – hier ein paar Empfehlungen der Brain City-Redaktion, um…→5 Tipps: zu Pfingsten in der Brain City Berlin
-
Insights Transfer – Stories
 © QAH
Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→
© QAH
Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→Tradition meets Innovation
-
Facts & Events
 © Adobe Stock/stockartstudio
Facts & EventsDie Humboldt-Universität zu Berlin hat den Frauenanteil an den Professuren in rund 15 Jahren fast verdoppelt. Bei den wissenschaftlichen…→
© Adobe Stock/stockartstudio
Facts & EventsDie Humboldt-Universität zu Berlin hat den Frauenanteil an den Professuren in rund 15 Jahren fast verdoppelt. Bei den wissenschaftlichen…→HU Berlin: mehr Frauen in der Wissenschaft
-
Facts & Events
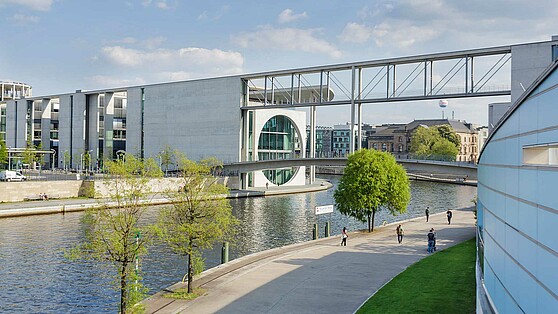 Credit: Berlin Partner/Wüstenhagen
Facts & EventsAm 23. und 24. März lädt das CityLAB Berlin Forscher*innen und Smart-City-Expert*innen zu einer Online-Konferenz ein. Die Ergebnisse sollen in die…→
Credit: Berlin Partner/Wüstenhagen
Facts & EventsAm 23. und 24. März lädt das CityLAB Berlin Forscher*innen und Smart-City-Expert*innen zu einer Online-Konferenz ein. Die Ergebnisse sollen in die…→Internationales Symposium zum Thema Smart City
-
Insights Transfer – Stories
 © HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→
© HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→Generative KI in Forschung und Lehre stärken
-
Transfer – Stories
 Susanne Plaumann (privat)
Transfer – StoriesEin Interview mit Brain City-Botschafterin Susanne Plaumann M.A., Zentrale Frauenbeauftragte an der Beuth Hochschule für Technik Berlin, anlässlich…→
Susanne Plaumann (privat)
Transfer – StoriesEin Interview mit Brain City-Botschafterin Susanne Plaumann M.A., Zentrale Frauenbeauftragte an der Beuth Hochschule für Technik Berlin, anlässlich…→„Karrieren sind für Wissenschaftlerinnen heute planbarer“
-
Transfer – Stories
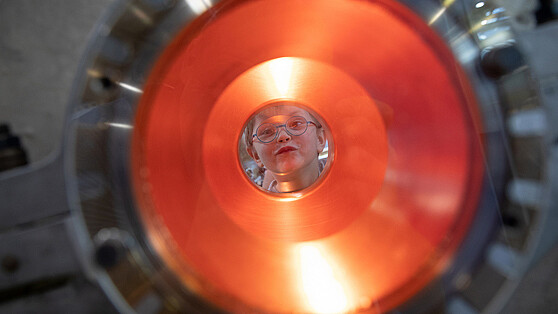 HZB/M. Setzpfandt
Transfer – StoriesIn Zeiten von Fake News und pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen fällt es vielen Menschen schwer, seriöse von unseriösen Inhalten zu…→
HZB/M. Setzpfandt
Transfer – StoriesIn Zeiten von Fake News und pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen fällt es vielen Menschen schwer, seriöse von unseriösen Inhalten zu…→„Wissenschaft muss neugierig machen“ | 11.06.2019
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesMit einem neuen Imagefilm startet Brain City Berlin ins Jahr 2023. Protagonistinnen und Protagonisten des Videos sind unsere Brain…→
© Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesMit einem neuen Imagefilm startet Brain City Berlin ins Jahr 2023. Protagonistinnen und Protagonisten des Videos sind unsere Brain…→„Wir sind Brain City Berlin“
-
Insights Transfer – Stories
 © Zukunftsorte Berlin
Insights Transfer – StoriesInterview mit Brain City Botschafter Steffen Terberl, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsorte.→
© Zukunftsorte Berlin
Insights Transfer – StoriesInterview mit Brain City Botschafter Steffen Terberl, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsorte.→„Damit in Berlin wieder Innovationsgeschichte geschrieben werden kann“
-
Facts & Events
 ©Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Facts & EventsNoch bis zum 14. November 2022 können Einzelpersonen und Gruppen Vorschläge für den Berliner Frauenpreis einreichen.→
©Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Facts & EventsNoch bis zum 14. November 2022 können Einzelpersonen und Gruppen Vorschläge für den Berliner Frauenpreis einreichen.→Berliner Frauenpreis 2023
-
Facts & Events
 Foto: Berlin University Alliance
Facts & Events„Wissen aus Berlin“ heißt ein Youtube-Kanal der Berlin University Alliance. Ende Mai ging die 2. Staffel der Kurzvideos an den Start. Jeweils…→
Foto: Berlin University Alliance
Facts & Events„Wissen aus Berlin“ heißt ein Youtube-Kanal der Berlin University Alliance. Ende Mai ging die 2. Staffel der Kurzvideos an den Start. Jeweils…→Spannende Videos aus der Berliner Forschung
-
Facts & Events
 © Agentur Medienlabor | Stefan Schubert
Facts & EventsDie Preisträgerinnen und Preisträger des Innovationspreises Berlin Brandenburg 2024 stehen fest. Insgesamt 125 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein.…→
© Agentur Medienlabor | Stefan Schubert
Facts & EventsDie Preisträgerinnen und Preisträger des Innovationspreises Berlin Brandenburg 2024 stehen fest. Insgesamt 125 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein.…→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2024
-
Transfer – Stories
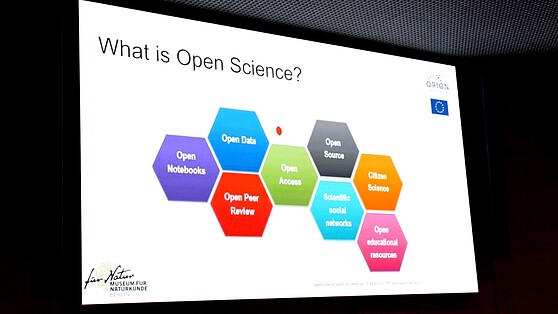 © Brain City Berlin
Transfer – StoriesForschungsergebnisse schnell und einfach zugänglich im Netz: Die Open-Access-Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im Publikationswesen und…→
© Brain City Berlin
Transfer – StoriesForschungsergebnisse schnell und einfach zugänglich im Netz: Die Open-Access-Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im Publikationswesen und…→Open Access: freies Wissen für alle
-
Facts & Events
 © DGZfP
Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften, Transfer Week oder World Health Summit – wir stellen Ihnen unsere Favoriten vor.→
© DGZfP
Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften, Transfer Week oder World Health Summit – wir stellen Ihnen unsere Favoriten vor.→Brain City Berlin 2023: Top-10 Events
-
Facts & Events
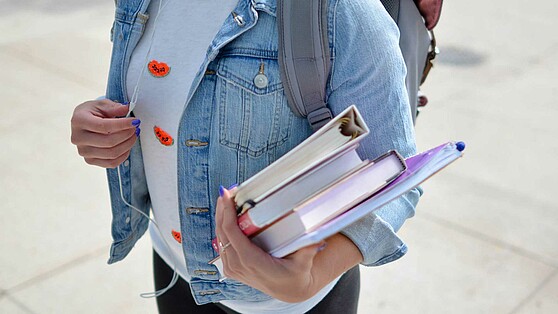 Credit: Element5 Digital on Unsplash
Facts & EventsDrei Semestern lang fanden Lehre und Studium auch in der Brain City Berlin überwiegend online statt. Jetzt öffnen Vorlesungssäle, Seminarräume, Labore…→
Credit: Element5 Digital on Unsplash
Facts & EventsDrei Semestern lang fanden Lehre und Studium auch in der Brain City Berlin überwiegend online statt. Jetzt öffnen Vorlesungssäle, Seminarräume, Labore…→Gute Voraussetzungen: Semesterstart 2021/22
-
Transfer – Stories
 ©fotografixx-istockphoto.com
Transfer – StoriesDas Lernverhalten im digitalen Zeitalter ändert sich grundlegend. Es stellt die Studierenden in den Mittelpunkt und ist technologieorientiert.→
©fotografixx-istockphoto.com
Transfer – StoriesDas Lernverhalten im digitalen Zeitalter ändert sich grundlegend. Es stellt die Studierenden in den Mittelpunkt und ist technologieorientiert.→Die Zukunft des Lernens erforschen
-
Transfer – Stories
 Credit: Rudolf Grillborzer
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Onur Günlü, Nachwuchsgruppenleiter und Dozent am Lehrstuhl für Informationstheorie und deren…→
Credit: Rudolf Grillborzer
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Onur Günlü, Nachwuchsgruppenleiter und Dozent am Lehrstuhl für Informationstheorie und deren…→Ausloten der „ultimativen Grenze“
-
Facts & Events
 © mfn / Carola Radke
Facts & EventsAm 6. Oktober lädt das Team von mit:forschen! zum ersten Campus Citizen Science ins Museum für Naturkunde Berlin ein.→
© mfn / Carola Radke
Facts & EventsAm 6. Oktober lädt das Team von mit:forschen! zum ersten Campus Citizen Science ins Museum für Naturkunde Berlin ein.→Campus Citizen Science: Künstliche Intelligenz
-
Facts & Events
 © Agentur Medienlabor
Facts & EventsDie Bewerbungsphase ist eröffnet: Bis zum 8. Juli können Unternehmen, Start-ups und Handwerksbetriebe mit Sitz in der Brain City Berlin oder in…→
© Agentur Medienlabor
Facts & EventsDie Bewerbungsphase ist eröffnet: Bis zum 8. Juli können Unternehmen, Start-ups und Handwerksbetriebe mit Sitz in der Brain City Berlin oder in…→Startschuss für Innovationspreis Berlin Brandenburg 2024
-
Insights Transfer – Stories
 © HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesIm Januar 2025 ist die European University Alliance EUonAIR an den Start gegangen. Mehr über den einzigartigen Hochschulverbund erzählt Brain City…→
© HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesIm Januar 2025 ist die European University Alliance EUonAIR an den Start gegangen. Mehr über den einzigartigen Hochschulverbund erzählt Brain City…→„Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“
-
Transfer – Stories
 Falk Weiß
Transfer – StoriesDas Wissensportal „humboldts17“ stellt aktuelle Forschung rund um das Thema Nachhaltigkeit vor und lädt zu einem Austausch mit der breiten…→
Falk Weiß
Transfer – StoriesDas Wissensportal „humboldts17“ stellt aktuelle Forschung rund um das Thema Nachhaltigkeit vor und lädt zu einem Austausch mit der breiten…→17 Ziele für die Zukunft
-
Insights Transfer – Stories
 © Gisma
Insights Transfer – StoriesSeit 2017 sitzt die Gisma University of Applied Sciences mit einem Campus in der Brain City Berlin. Mehr als 660 Studierende aus aller Welt werden an…→
© Gisma
Insights Transfer – StoriesSeit 2017 sitzt die Gisma University of Applied Sciences mit einem Campus in der Brain City Berlin. Mehr als 660 Studierende aus aller Welt werden an…→Praxisorientiert studieren und der Wirtschaft Impulse geben
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin University Alliance / Stefan Klenke
Insights Transfer – StoriesMit dem innovate! lab will die Berlin University Alliance Spitzenforschung schnell und zielgerichtet in die Praxis bringen. BUA-Geschäftsführerin Dr.…→
© Berlin University Alliance / Stefan Klenke
Insights Transfer – StoriesMit dem innovate! lab will die Berlin University Alliance Spitzenforschung schnell und zielgerichtet in die Praxis bringen. BUA-Geschäftsführerin Dr.…→„Forschungstransfer durch Agilität“
-
Facts & Events
 © Falling Walls Foundation
Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November steht die Brain City Berlin wieder weltweit im Spotlight. Das vielfältige Programm der 9. Berlin Science Week umfasst mehr…→
© Falling Walls Foundation
Facts & EventsVom 1. bis zum 10. November steht die Brain City Berlin wieder weltweit im Spotlight. Das vielfältige Programm der 9. Berlin Science Week umfasst mehr…→Gemeinsame Wege finden: Berlin Science Week 2024
-
Insights
 © Jens Freudenberg
InsightsInterview mit Prof. Cordula Endter, Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen…→
© Jens Freudenberg
InsightsInterview mit Prof. Cordula Endter, Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen…→Weitaus mehr als Bedarfsanalysen – Co-Creation
-
Innovationen
 Shutterstock/ Jacob Lund
InnovationenDie Hauptstadt besetzt fast die Hälfte der Professuren mit Wissenschaftlerinnen: 48 Prozent der im ersten Halbjahr 2019 von Berliner Hochschulen…→
Shutterstock/ Jacob Lund
InnovationenDie Hauptstadt besetzt fast die Hälfte der Professuren mit Wissenschaftlerinnen: 48 Prozent der im ersten Halbjahr 2019 von Berliner Hochschulen…→Berlin Vorreiterin in Sachen Gleichstellung |10.07.2019
-
Facts & Events
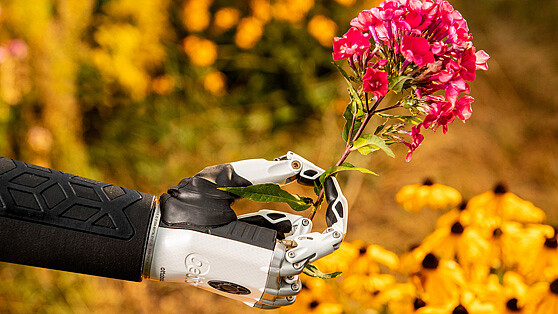 Ottobock
Facts & EventsLetzter Schultag in Berlin. Endlich Ferien! Doch lernen kann man in der Brain City Berlin auch im Sommer überall. Ein spannendes Ferienprogramm für…→
Ottobock
Facts & EventsLetzter Schultag in Berlin. Endlich Ferien! Doch lernen kann man in der Brain City Berlin auch im Sommer überall. Ein spannendes Ferienprogramm für…→Schlau durch die Sommerferien | 19.06.2019
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Maschinenraum
Facts & Events Transfer – StoriesÜber die Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Mittelstandsnetzwerk will die Hochschule für Technik und Wirtschaft weiteres Transferpotenzial…→
© Maschinenraum
Facts & Events Transfer – StoriesÜber die Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Mittelstandsnetzwerk will die Hochschule für Technik und Wirtschaft weiteres Transferpotenzial…→HTW Berlin kooperiert mit Maschinenraum
-
Transfer – Stories
 BHT/Marti Gasch
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Ivo Boblan, Professor am Studiengang Humanoide Robotik der Berliner Hochschule für Technik, erforscht…→
BHT/Marti Gasch
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Ivo Boblan, Professor am Studiengang Humanoide Robotik der Berliner Hochschule für Technik, erforscht…→„Roboter können uns ganz viel abnehmen“
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin Partner/Eventfotografen
Insights Transfer – StoriesDie Forschungslandschaft in Berlin und Brandenburg ist hervorragend, aber recht fragmentiert. Das Konsortium UNITE will das ändern.→
© Berlin Partner/Eventfotografen
Insights Transfer – StoriesDie Forschungslandschaft in Berlin und Brandenburg ist hervorragend, aber recht fragmentiert. Das Konsortium UNITE will das ändern.→UNITE: Synergien fördern, Innovationen beschleunigen
-
Insights Transfer – Stories
 © WISTA Management GmbH – www.adlershof.de
Insights Transfer – StoriesDer Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist der größte der insgesamt elf Berliner Zukunftsorte. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und…→
© WISTA Management GmbH – www.adlershof.de
Insights Transfer – StoriesDer Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist der größte der insgesamt elf Berliner Zukunftsorte. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und…→„Wir leben von der Nähe und dem Austausch“
-
Facts & Events
 © Berlin Partner. Copyright: Wüstenhagen
Facts & EventsWeltkrebstag 2026: Wie Berliner Forschung die Frauengesundheit stärkt.→
© Berlin Partner. Copyright: Wüstenhagen
Facts & EventsWeltkrebstag 2026: Wie Berliner Forschung die Frauengesundheit stärkt.→Weltkrebstag 2026: Wie Berliner Forschung die Frauengesundheit stärkt
-
Facts & Events
 Peitz/Charité
Facts & EventsDie Brain City Berlin bekommt wieder einmal hochkarätigen Zuwachs: Die Medizinerin und Epidemiologin Prof. Dr. Dr. Sabine Gabrysch ist die bundesweit…→
Peitz/Charité
Facts & EventsDie Brain City Berlin bekommt wieder einmal hochkarätigen Zuwachs: Die Medizinerin und Epidemiologin Prof. Dr. Dr. Sabine Gabrysch ist die bundesweit…→Bundesweit erste Professur für Klimawandel und Gesundheit in Berlin | 26.06.2019
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Tu Berlin / allefarben-foto
Facts & Events Transfer – StoriesDrohnen-Logistik, Baustoff-Recycling und Wiederverwendung von Abwasser: Diese drei Ideen sollen in den kommenden drei Jahren in Reallaboren praxisnah…→
© Tu Berlin / allefarben-foto
Facts & Events Transfer – StoriesDrohnen-Logistik, Baustoff-Recycling und Wiederverwendung von Abwasser: Diese drei Ideen sollen in den kommenden drei Jahren in Reallaboren praxisnah…→Drei Berliner Reallabore gehen an den Start
-
Facts & Events
 © TU Berlin / Philipp Arnoldt
Facts & EventsIn der gemeinsamen Bibliothek von TU Berlin und UdK Berlin wird dies ab 2025 möglich sein. Der Berliner Senat hat dem Modellprojekt zugestimmt.→
© TU Berlin / Philipp Arnoldt
Facts & EventsIn der gemeinsamen Bibliothek von TU Berlin und UdK Berlin wird dies ab 2025 möglich sein. Der Berliner Senat hat dem Modellprojekt zugestimmt.→Lernen in der Uni-Bibliothek bald 24/7
-
Transfer – Stories
 Thomas Rosenthal - Museum für Naturkunde Berlin
Transfer – Stories660 Millionen Euro in 10 Jahren: Das Museum für Naturkunde Berlin erhält finanzielle Unterstützung für die Weiterentwicklung der Erforschung der…→
Thomas Rosenthal - Museum für Naturkunde Berlin
Transfer – Stories660 Millionen Euro in 10 Jahren: Das Museum für Naturkunde Berlin erhält finanzielle Unterstützung für die Weiterentwicklung der Erforschung der…→Zukunft des Museums für Naturkunde Berlin | 14.01.2019
-
Facts & Events
 xg-incubator.com
Facts & EventsNoch bis zum 31. März können Start-ups und Gründer:innen ihre Unterlagen für den neuen xG-Incubator von TU Berlin und Fraunhofer HHI einreichen.→
xg-incubator.com
Facts & EventsNoch bis zum 31. März können Start-ups und Gründer:innen ihre Unterlagen für den neuen xG-Incubator von TU Berlin und Fraunhofer HHI einreichen.→Jetzt bewerben! Ideen für die Zukunft der Kommunikation
-
Facts & Events
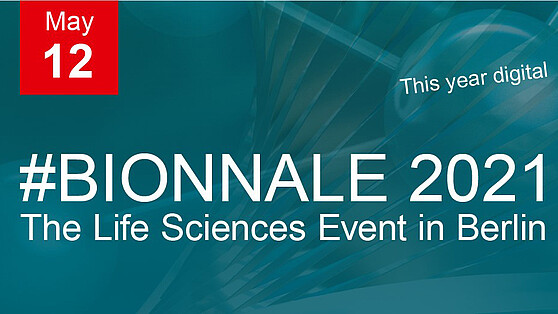 Facts & EventsUm aktuelle technologische Entwicklungen im Bereich Life Sciences, Austausch und Netzwerken geht es am 12. Mai auf der BIONNALE.→
Facts & EventsUm aktuelle technologische Entwicklungen im Bereich Life Sciences, Austausch und Netzwerken geht es am 12. Mai auf der BIONNALE.→BIONNALE 2021 – jetzt anmelden!
-
Insights Transfer – Stories
 © vdo
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Claus Bull und Dipl.-Ing. Dirk Jäger untersuchen an der Berliner Hochschule für Technik, was Straßenbäume zum Überleben brauchen und wie sie…→
© vdo
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Claus Bull und Dipl.-Ing. Dirk Jäger untersuchen an der Berliner Hochschule für Technik, was Straßenbäume zum Überleben brauchen und wie sie…→„Wir muten den Bäumen in der Stadt ganz schön viel zu“
-
Facts & Events
 © Graziela Diez
Facts & EventsMit ihrem Projekt „Data Worker’s Inquiry“ macht die Berliner Soziologin und Informatikerin auf Missstände in der KI-Arbeit aufmerksam.→
© Graziela Diez
Facts & EventsMit ihrem Projekt „Data Worker’s Inquiry“ macht die Berliner Soziologin und Informatikerin auf Missstände in der KI-Arbeit aufmerksam.→Dr. Milagros Miceli auf TIME-100-Liste der einflussreichsten Menschen im KI-Bereich
-
Facts & Events
 © Shutterstock/Sineeho
Facts & EventsForschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben in einer Metaanalyse untersucht, wer besonders anfällig für online gestreute…→
© Shutterstock/Sineeho
Facts & EventsForschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben in einer Metaanalyse untersucht, wer besonders anfällig für online gestreute…→Fake News: Wer fällt warum darauf rein?
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © BPWT
Facts & Events Transfer – StoriesMit einer ganztägigen Auftaktkonferenz in den stilwerk KantGaragen geht die Transfer Week Berlin-Brandenburg 2023 an den Start.→
© BPWT
Facts & Events Transfer – StoriesMit einer ganztägigen Auftaktkonferenz in den stilwerk KantGaragen geht die Transfer Week Berlin-Brandenburg 2023 an den Start.→„Wissenschaft x Wirtschaft“: Transfer Week 2023
-
Transfer – Stories
 Transfer – StoriesDie Literaturwissenschaftlerin Dr. Betiel Wasihun war wissenschaftlich international unterwegs. Nach Stationen in Heidelberg, Yale und Oxford zog es…→
Transfer – StoriesDie Literaturwissenschaftlerin Dr. Betiel Wasihun war wissenschaftlich international unterwegs. Nach Stationen in Heidelberg, Yale und Oxford zog es…→„Berlin ist ein perfekter Standort. Vor allem, wenn man wissenschaftlich nicht eingleisig fahren möchte“ | 12.08.2019
-
Facts & Events
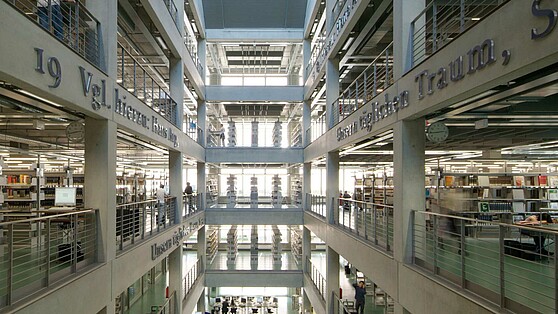 © TU Berlin / Ulrich Dahl
Facts & EventsDie TU Berlin beteiligt sich mit dem Verlag BerlinUP aktiv am Aufbau der nationalen Servicestelle für Diamond Open Access (SeDOA).→
© TU Berlin / Ulrich Dahl
Facts & EventsDie TU Berlin beteiligt sich mit dem Verlag BerlinUP aktiv am Aufbau der nationalen Servicestelle für Diamond Open Access (SeDOA).→Offene Wissenschaft stärken
-
Facts & Events
 © Dirk Lamprecht / Visual Noise
Facts & EventsMit einem „KULen Tag der Wissenschaft" und einer spannenden Vorlesungsreihe feiert die KinderUni Lichtenberg in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.→
© Dirk Lamprecht / Visual Noise
Facts & EventsMit einem „KULen Tag der Wissenschaft" und einer spannenden Vorlesungsreihe feiert die KinderUni Lichtenberg in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.→Von „Süß, lecker – und gefährlich“ bis „freihändig Fahrrad fahren“ – KULe Vorlesungen für Kinder
-
Transfer – Stories
 © HTW Berlin / Nikolas Fahlbusch
Transfer – StoriesLehre findet momentan ausschließlich online statt. Gastautorin Dr. Dorothee Haffner, Professorin im Studiengang Museumskunde der Hochschule für…→
© HTW Berlin / Nikolas Fahlbusch
Transfer – StoriesLehre findet momentan ausschließlich online statt. Gastautorin Dr. Dorothee Haffner, Professorin im Studiengang Museumskunde der Hochschule für…→Gastbeitrag: „Online-Lehre ist lebhafter, als ich gedacht habe“
-
Transfer – Stories
 Berlin Partner / Wüstenhagen
Transfer – StoriesWissenschaft und Kulturerbe, jederzeit für jedermann frei zugänglich im Netz: Die Open Access Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im…→
Berlin Partner / Wüstenhagen
Transfer – StoriesWissenschaft und Kulturerbe, jederzeit für jedermann frei zugänglich im Netz: Die Open Access Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im…→Wissen für Alle - Open Access in Berlin | 28.03.2019
-
Facts & Events
 © Max Delbrück Center / Felix Petermann
Facts & EventsDr. Gabriele Schiattarella ist von der International Society for Heart Research mit dem „Outstanding Investigator Award“ gewürdigt worden. Der…→
© Max Delbrück Center / Felix Petermann
Facts & EventsDr. Gabriele Schiattarella ist von der International Society for Heart Research mit dem „Outstanding Investigator Award“ gewürdigt worden. Der…→Berliner Herzforscher ausgezeichnet
-
Transfer – Stories
 Foto: ESCP Business School Berlin
Transfer – StoriesWas tun, wenn in der Lehre auf einmal Distanz verordnet ist? Ein Gastbeitrag von Dr. René Mauer, Professor für Entrepreneurship und Innovation an der…→
Foto: ESCP Business School Berlin
Transfer – StoriesWas tun, wenn in der Lehre auf einmal Distanz verordnet ist? Ein Gastbeitrag von Dr. René Mauer, Professor für Entrepreneurship und Innovation an der…→Mit Whiteboards gegen die digitale Müdigkeit
-
Facts & Events
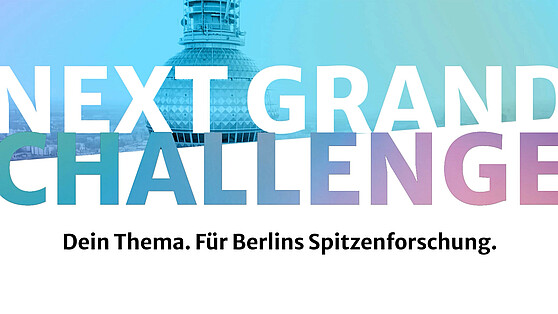 @ BUA
Facts & EventsJugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sowie Forschende und Studierende können aktuell Vorschläge für die „Next Grand Challenge“ der Berlin…→
@ BUA
Facts & EventsJugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sowie Forschende und Studierende können aktuell Vorschläge für die „Next Grand Challenge“ der Berlin…→Berlin University Alliance: Ideen gesucht!
-
Insights
 © Shutterstock / Andrii Yalanskyi
InsightsWissenschaft alltagsnah und allgemeinverständlich zu vermitteln – das ist der Ansatz von Prof. Dr. Sascha Friesike. Der Brain City Botschafter ist…→
© Shutterstock / Andrii Yalanskyi
InsightsWissenschaft alltagsnah und allgemeinverständlich zu vermitteln – das ist der Ansatz von Prof. Dr. Sascha Friesike. Der Brain City Botschafter ist…→„Wissenschaft muss selbst erklären können, was sie tut“
-
Facts & Events
 Shutterstock © LightField Studios
Facts & EventsHU Berlin, TU Berlin, ASH Berlin, BHT und HfS Ernst Busch – diese Berliner Hochschulen sind in der ersten Runde des Professorinnenprogramms 2030 der…→
Shutterstock © LightField Studios
Facts & EventsHU Berlin, TU Berlin, ASH Berlin, BHT und HfS Ernst Busch – diese Berliner Hochschulen sind in der ersten Runde des Professorinnenprogramms 2030 der…→Professorinnenprogramm 2030: fünf Berliner Hochschulen ausgewählt
-
Facts & Events
 Florian Reimann
Facts & EventsDie Zukunft der Stadt – wie könnte sie aussehen? Im CityLAB Berlin soll dies durchdacht und erforscht werden. Das Berliner Experimentierlabor wurde…→
Florian Reimann
Facts & EventsDie Zukunft der Stadt – wie könnte sie aussehen? Im CityLAB Berlin soll dies durchdacht und erforscht werden. Das Berliner Experimentierlabor wurde…→Labor für die Digitalisierung Berlins | 13.06.2019
-
Facts & Events
 Foto: @Harf Zimmermann, 3-D-Visualisierung@ Tonio Freitag
Facts & Events„Berlin will’s wissen“: Mit einer großen Open-Air-Ausstellung vor dem Roten Rathaus geht die „Wissensstadt Berlin 2021“ an den Start.→
Foto: @Harf Zimmermann, 3-D-Visualisierung@ Tonio Freitag
Facts & Events„Berlin will’s wissen“: Mit einer großen Open-Air-Ausstellung vor dem Roten Rathaus geht die „Wissensstadt Berlin 2021“ an den Start.→„Wissensstadt Berlin 2021“ – Festival des Forschens
-
Transfer – Stories
 Foto: Shutterstock © Yurchanka Siarhei
Transfer – Stories22 Millionen Euro wird das Berliner KI-Kompetenzzentrum BIFOLD künftig jährlich vom Bund und dem Land Berlin erhalten.→
Foto: Shutterstock © Yurchanka Siarhei
Transfer – Stories22 Millionen Euro wird das Berliner KI-Kompetenzzentrum BIFOLD künftig jährlich vom Bund und dem Land Berlin erhalten.→Millionenförderung für Berliner KI-Forschung
-
Facts & Events
 © DFG/David Ausserhofer
Facts & EventsDie Geisteswissenschaftlerin Prof. Dr. Anita Traninger hat am vergangenen Mittwoch in der Brain City Berlin den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023…→
© DFG/David Ausserhofer
Facts & EventsDie Geisteswissenschaftlerin Prof. Dr. Anita Traninger hat am vergangenen Mittwoch in der Brain City Berlin den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023…→Leibniz-Preis für FU-Professorin Anita Traninger
-
Transfer – Stories
 ©DexLeChem
Transfer – StoriesAus der Hochschule heraus ein Start-up gründen? Sonja Jost machte es erfolgreich vor. Gemeinsam mit drei Kommiliton*innen gründete sie nach dem…→
©DexLeChem
Transfer – StoriesAus der Hochschule heraus ein Start-up gründen? Sonja Jost machte es erfolgreich vor. Gemeinsam mit drei Kommiliton*innen gründete sie nach dem…→„Neue Erkenntnisse in den Markt zu bringen, ist uns sehr wichtig“
-
Insights Transfer – Stories
 Shutterstock © Monster Ztudio
Insights Transfer – StoriesMithilfe von Künstlicher Intelligenz will das in der Brain City Berlin verankerte, interdisziplinäre Forschungsprojekt manipulierte Medien-Inhalte…→
Shutterstock © Monster Ztudio
Insights Transfer – StoriesMithilfe von Künstlicher Intelligenz will das in der Brain City Berlin verankerte, interdisziplinäre Forschungsprojekt manipulierte Medien-Inhalte…→„news-polygraph“: Förderung durch BMBF
-
Facts & Events
 © Berlin Partner / Wüstenhagen
Facts & EventsDie Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft steht vom 24. bis zum 28. November 2025 wieder im Fokus der Transfer Week Berlin-Brandenburg.→
© Berlin Partner / Wüstenhagen
Facts & EventsDie Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft steht vom 24. bis zum 28. November 2025 wieder im Fokus der Transfer Week Berlin-Brandenburg.→Transfer Week Berlin-Brandenburg 2025
-
Transfer – Stories
 Foto: Hannah Kerkhoff
Transfer – StoriesProf. Dr. Johannes Gräske, Leiter des Studiengangs Pflege an der ASH Berlin, im Brain City-Interview.→
Foto: Hannah Kerkhoff
Transfer – StoriesProf. Dr. Johannes Gräske, Leiter des Studiengangs Pflege an der ASH Berlin, im Brain City-Interview.→Mit Akademisierung dem Pflexit begegnen
-
Insights Transfer – Stories
 Design © Sarah Engler; Foto © Alexander Bob
Insights Transfer – StoriesBrain City-Interview mit Prof. Dr. Uwe Bettig. Als Professor für Management und Betriebswirtschaft an der ASH Berlin leitet er das IFAF-Projekt…→
Design © Sarah Engler; Foto © Alexander Bob
Insights Transfer – StoriesBrain City-Interview mit Prof. Dr. Uwe Bettig. Als Professor für Management und Betriebswirtschaft an der ASH Berlin leitet er das IFAF-Projekt…→Viele kreative Ideen und Ansätze
-
Facts & Events
 li: TU Berlin, Pressestelle / re. Marten Körner
Facts & EventsGleich mehrere Forscher*innen der Brain City Berlin sind aktuell mit hochkarätigen Förderpreisen ausgezeichnet worden. Den Gottfried Wilhelm…→
li: TU Berlin, Pressestelle / re. Marten Körner
Facts & EventsGleich mehrere Forscher*innen der Brain City Berlin sind aktuell mit hochkarätigen Förderpreisen ausgezeichnet worden. Den Gottfried Wilhelm…→7 hochkarätige Forschungspreise für Berliner Wissenschaftler*innen
-
Transfer – Stories
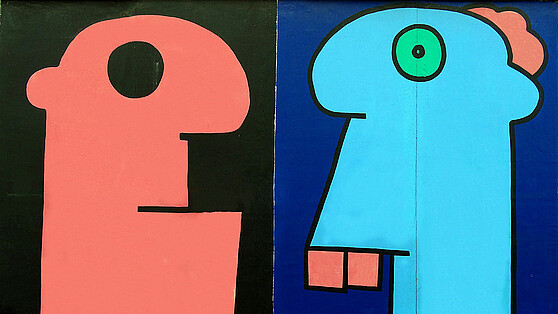 ©Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
Transfer – StoriesViele hochkarätige Wissenschaftler*innen zieht es jährlich in die Brain City Berlin. Das Dual Career Network Berlin unterstützt Partner*innen von…→
©Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
Transfer – StoriesViele hochkarätige Wissenschaftler*innen zieht es jährlich in die Brain City Berlin. Das Dual Career Network Berlin unterstützt Partner*innen von…→Dual Career Network Berlin – Fuß fassen in Berlin
-
Facts & Events
 Credit: Harf Zimmermann/3-D-Visualisierung: Tonio Freitag
Facts & EventsBerlin feiert Wissenschaft. Wir haben einige Highlights für Sie zusammengestellt.→
Credit: Harf Zimmermann/3-D-Visualisierung: Tonio Freitag
Facts & EventsBerlin feiert Wissenschaft. Wir haben einige Highlights für Sie zusammengestellt.→„Wissensstadt Berlin 2021“ – unsere Top 10
-
Facts & Events
 TU Berlin/Dahl
Facts & EventsBerlin ist einer der spannendsten Wissenschaftsstandorte weltweit. Internationalität, Interdisziplinarität, und eine große Bandbreite an Expertise…→
TU Berlin/Dahl
Facts & EventsBerlin ist einer der spannendsten Wissenschaftsstandorte weltweit. Internationalität, Interdisziplinarität, und eine große Bandbreite an Expertise…→Brain City Berlin – im freien Dialog mit der Welt | 13.05.2019
-
Facts & Events
 © FU Berlin / Svea Pietschmann
Facts & Events„Freies Denken. Verantwortung bilden. Veränderung gestalten.“ Unter diesem Motto feiert die Freie Universität Berlin in diesem Jahr ihren 75.…→
© FU Berlin / Svea Pietschmann
Facts & Events„Freies Denken. Verantwortung bilden. Veränderung gestalten.“ Unter diesem Motto feiert die Freie Universität Berlin in diesem Jahr ihren 75.…→75 Jahre Freie Universität Berlin
-
Transfer – Stories
 Swen Hutter (Foto: David Ausserhofer), Gesine Höltmann (Foto: Martina Sander)
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Gesine Höltmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung und und Swen Hutter, stellvertretender…→
Swen Hutter (Foto: David Ausserhofer), Gesine Höltmann (Foto: Martina Sander)
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Gesine Höltmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung und und Swen Hutter, stellvertretender…→Polarisierung und Zusammenhalt in der Corona-Krise
-
Insights Innovationen
 © Berlin Institute for Innovation
Insights Innovationen„Innovation = Invention + Marktdurchdringung“, so die Arbeitsformel des Berlin Institute for Innovation. Wissenschaftlich fundiert betrachtet das BIFI…→
© Berlin Institute for Innovation
Insights Innovationen„Innovation = Invention + Marktdurchdringung“, so die Arbeitsformel des Berlin Institute for Innovation. Wissenschaftlich fundiert betrachtet das BIFI…→Die Forschungsmanufaktur
-
Talent
 ©Jordan Katz
Talent„Think like a Scientist“, „Dream like an Artist“, „Identify value“, „Act like an Entrepreneur“ – mit diesen vier Stufen stößt das „RIDE thinking…→
©Jordan Katz
Talent„Think like a Scientist“, „Dream like an Artist“, „Identify value“, „Act like an Entrepreneur“ – mit diesen vier Stufen stößt das „RIDE thinking…→Mitmachen, Netzwerken, Zukunftsvisionen entwickeln – das Brain City Berlin-Sommerfest | 3.09.2019
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Alfred-Wegener-Institut/Micheal Gutsche (CC-BY 4.0)
Facts & Events Transfer – StoriesEine Sonderausstellung im Deutschen Technikmuseum macht eiswürfelklar: Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Arktis zu retten.→
© Alfred-Wegener-Institut/Micheal Gutsche (CC-BY 4.0)
Facts & Events Transfer – StoriesEine Sonderausstellung im Deutschen Technikmuseum macht eiswürfelklar: Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Arktis zu retten.→Ausstellungstipp: „Dünnes Eis“
-
Insights Transfer – Stories
 © Hallbauer & Fioretti
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, Nobelpreisträgerin und geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die…→
© Hallbauer & Fioretti
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, Nobelpreisträgerin und geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die…→„Grundlagenforschung ist die Basis für Innovationen“
-
Facts & Events
 Shutterstock©Gorondenkoff
Facts & EventsBerlin soll zu einem international führenden Zentrum für Künstliche Intelligenz werden. Ein Meilenstein für die Erforschung von KI in der Brain City…→
Shutterstock©Gorondenkoff
Facts & EventsBerlin soll zu einem international führenden Zentrum für Künstliche Intelligenz werden. Ein Meilenstein für die Erforschung von KI in der Brain City…→BIFOLD – dauerhafte Förderung gesichert
-
Insights Transfer – Stories
 © TU Berlin/Felix Noak
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Giuseppe Caire forscht an der TU Berlin an einer neuen Übertragungsmethode, die drahtlose Kommunikation revolutionieren könnte.→
© TU Berlin/Felix Noak
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Giuseppe Caire forscht an der TU Berlin an einer neuen Übertragungsmethode, die drahtlose Kommunikation revolutionieren könnte.→Drahtlose Kommunikation völlig neu gedacht
-
Insights Facts & Events
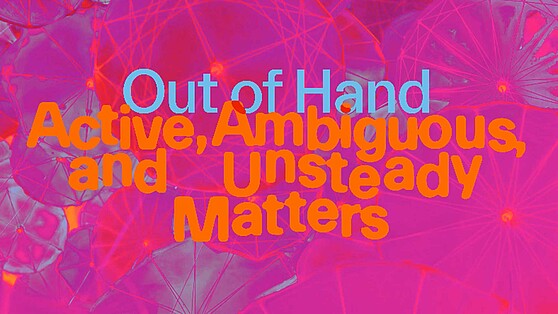 © Matters of Activity / HU Berlin
Insights Facts & EventsAm 19. September veranstaltet das Exzellenzcluster „Matters of Activity" seine Jahreskonferenz. Brain City Interview mit Dr. Christian Stein.→
© Matters of Activity / HU Berlin
Insights Facts & EventsAm 19. September veranstaltet das Exzellenzcluster „Matters of Activity" seine Jahreskonferenz. Brain City Interview mit Dr. Christian Stein.→„Wir bringen das Material auf Augenhöhe“
-
Transfer – Stories
 Credit: Mimi Thian on Unsolash
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain-City-Botschafter Dr. Petyo Budakov, University of Europe for Applied Sciences.→
Credit: Mimi Thian on Unsolash
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain-City-Botschafter Dr. Petyo Budakov, University of Europe for Applied Sciences.→„Mit Stolz präsentiert: die Brain City Berlin 2020“
-
Insights Transfer – Stories
 © HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDas Projekt „Zukunft findet Stadt – Hochschulnetzwerk für ein resilientes Berlin“ ist für Berlin bisher einzigartig. Mehr erzählt Projektleiterin…→
© HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDas Projekt „Zukunft findet Stadt – Hochschulnetzwerk für ein resilientes Berlin“ ist für Berlin bisher einzigartig. Mehr erzählt Projektleiterin…→„Wir wollen, dass Innovationen, die in Berlin entstehen, hier auch umgesetzt werden“
-
Insights Transfer – Stories
 © HWR Berlin/Franziska Ihle
Insights Transfer – StoriesIm Projekt „KlinKe“ erforschen Prof. Dr. Silke Bustamante und Prof. Dr. Andrea Pelzeter an der HWR Berlin, welche Sekundärprozesse im Krankenhaus…→
© HWR Berlin/Franziska Ihle
Insights Transfer – StoriesIm Projekt „KlinKe“ erforschen Prof. Dr. Silke Bustamante und Prof. Dr. Andrea Pelzeter an der HWR Berlin, welche Sekundärprozesse im Krankenhaus…→Auf dem Weg zum klimaneutralen Krankenhaus
-
Facts & Events Transfer – Stories
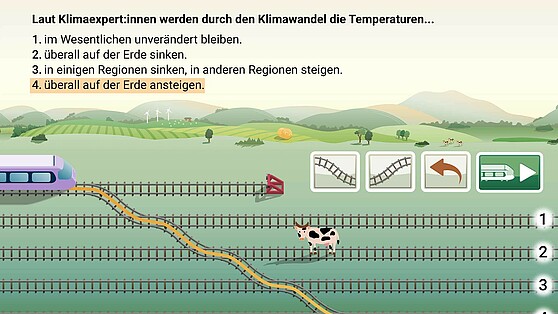 © HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDie App „TRAIN 4 Science“ regt Kinder, aber auch Erwachsene spielerisch dazu an, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Konzipiert und…→
© HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDie App „TRAIN 4 Science“ regt Kinder, aber auch Erwachsene spielerisch dazu an, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Konzipiert und…→Mit dem virtuellen Zug in eine nachhaltige Zukunft
-
Facts & Events
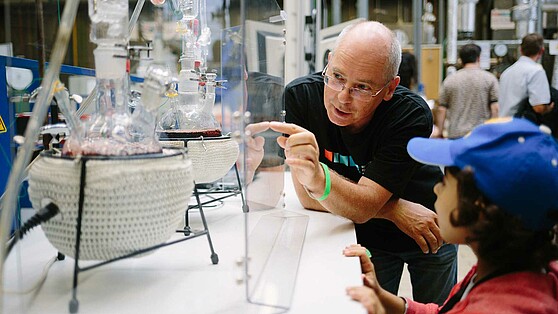 Foto: htw berlin © Zarko Martovic
Facts & EventsAm 2. Juli 2022 findet die Lange Nacht der Wissenschaften wieder live und vor Ort in der Brain City Berlin statt. Mehr als 60 wissenschaftliche und…→
Foto: htw berlin © Zarko Martovic
Facts & EventsAm 2. Juli 2022 findet die Lange Nacht der Wissenschaften wieder live und vor Ort in der Brain City Berlin statt. Mehr als 60 wissenschaftliche und…→LNDW 2022 – die Welt der Wissenschaft erkunden
-
Transfer – Stories
 HTW Berlin
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafter Prof. Dr. Kai Reinhardt. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Gast beim 2. SpreeTalk der HTW Berlin am 29. 10.…→
HTW Berlin
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafter Prof. Dr. Kai Reinhardt. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Gast beim 2. SpreeTalk der HTW Berlin am 29. 10.…→„Die Corona-Krise wirkt als Katalysator der Digitalisierung“
-
Facts & Events
 © Retusche: Ralitsa Kirova/Wissenschaft im Dialog CCBY-SA4.0
Facts & EventsAm 14. Mai begibt sich das schwimmende Science Center „MS Wissenschaft“ mit einer interaktiven Ausstellung zum Thema „Freiheit“ erneut auf große Fahrt…→
© Retusche: Ralitsa Kirova/Wissenschaft im Dialog CCBY-SA4.0
Facts & EventsAm 14. Mai begibt sich das schwimmende Science Center „MS Wissenschaft“ mit einer interaktiven Ausstellung zum Thema „Freiheit“ erneut auf große Fahrt…→Leinen los! MS Wissenschaft wieder auf Tour
-
Facts & Events
 © HWR Berlin/Lukas Schramm
Facts & EventsStudieren – ja. Doch an welcher Hochschule? Und vor allem: welches Fach? Auch in diesem Jahr laden die Berliner Universitäten und Hochschulen wieder…→
© HWR Berlin/Lukas Schramm
Facts & EventsStudieren – ja. Doch an welcher Hochschule? Und vor allem: welches Fach? Auch in diesem Jahr laden die Berliner Universitäten und Hochschulen wieder…→Studieninfotage 2024
-
Transfer – Stories
 ©BIH|Thomas Rafalzyk
Transfer – StoriesAm Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) geht es vor allem um „Translation“: die Übertragung von Erkenntnissen aus dem Forschungslabor in…→
©BIH|Thomas Rafalzyk
Transfer – StoriesAm Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) geht es vor allem um „Translation“: die Übertragung von Erkenntnissen aus dem Forschungslabor in…→„Es gibt es inzwischen viele tolle Wissenschaftlerinnen, die Großartiges leisten“
-
Facts & Events
 Credit: Lars Hübner
Facts & EventsBrain City-Botschafter Prof. Dr. Christian Drosten ist für seine herausragenden Forschungsleistungen mit dem Berliner Wissenschaftspreis 2020…→
Credit: Lars Hübner
Facts & EventsBrain City-Botschafter Prof. Dr. Christian Drosten ist für seine herausragenden Forschungsleistungen mit dem Berliner Wissenschaftspreis 2020…→Berliner Wissenschaftspreis 2020 für Christian Drosten
-
Insights Transfer – Stories
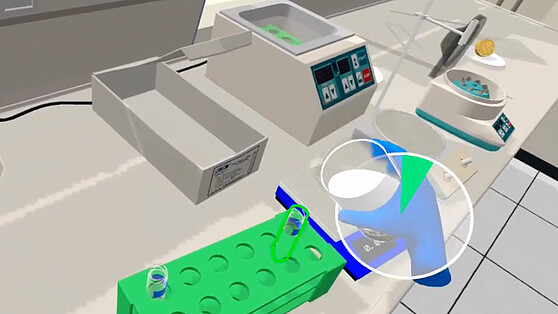 © BHT-MINT-VR-Labs
Insights Transfer – StoriesIn den MINT-VR-Labs an der Berliner Hochschule für Technik arbeitet ein interdisziplinäres Team an didaktischen Konzepten für virtuelle Labore und…→
© BHT-MINT-VR-Labs
Insights Transfer – StoriesIn den MINT-VR-Labs an der Berliner Hochschule für Technik arbeitet ein interdisziplinäres Team an didaktischen Konzepten für virtuelle Labore und…→Spielerisch lernen im virtuellen Biolabor
-
Facts & Events
 Credit: thisisenginieering/raeng on Unsplah
Facts & EventsBis 20. August anmelden! Mit einer Wikipedia-Schreibwerkstatt wollen das Berlin Institute of Health und die Senatskanzlei die Sichtbarkeit von Berlin…→
Credit: thisisenginieering/raeng on Unsplah
Facts & EventsBis 20. August anmelden! Mit einer Wikipedia-Schreibwerkstatt wollen das Berlin Institute of Health und die Senatskanzlei die Sichtbarkeit von Berlin…→Edit-a-thon: für mehr Wissenschaftlerinnen auf Wikipedia
-
Facts & Events
 ©BIT6
Facts & EventsDie Corona-Krise stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen. Am 20. Mai sprechen Expert*innen aus der…→
©BIT6
Facts & EventsDie Corona-Krise stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen. Am 20. Mai sprechen Expert*innen aus der…→TRAO – digitaler Transfer-Tag am 20. Mai
-
Insights Transfer – Stories
 © HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesAm Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Schöneweide trifft Tradition auf Ideen und Lösungen von morgen. Der wissenschaftliche Nucleus des…→
© HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesAm Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Schöneweide trifft Tradition auf Ideen und Lösungen von morgen. Der wissenschaftliche Nucleus des…→Ort der Innovation und Transformation
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Christian Kielmann
Facts & Events Transfer – StoriesAuf dem Campus der TU Berlin entsteht die europaweit größte Laborinfrastruktur für Transferteams im Bereich der Grünen Chemie. Die „Chemical Invention…→
© Christian Kielmann
Facts & Events Transfer – StoriesAuf dem Campus der TU Berlin entsteht die europaweit größte Laborinfrastruktur für Transferteams im Bereich der Grünen Chemie. Die „Chemical Invention…→Spatenstich für „Chemical Invention Factory“
-
Facts & Events
 Berlin Partner / Scholvien
Facts & EventsIn dem weltweit anerkannten QS University Ranking schnitten die Berliner Universitäten in vielen Fachbereichen sehr gut ab. Sie sind 30 Mal unter den…→
Berlin Partner / Scholvien
Facts & EventsIn dem weltweit anerkannten QS University Ranking schnitten die Berliner Universitäten in vielen Fachbereichen sehr gut ab. Sie sind 30 Mal unter den…→QS World University Ranking 2019 - Berliner Unis in vielen Fächern weltweit unter den Besten | 21.03.2019
-
Facts & Events
 © Shutterstock. AI Generator
Facts & EventsSind feste Beziehungen wichtiger für Frauen oder für Männer? Eine Studie, an der das Institut für Psychologie der HU Berlin federführend beteiligt…→
© Shutterstock. AI Generator
Facts & EventsSind feste Beziehungen wichtiger für Frauen oder für Männer? Eine Studie, an der das Institut für Psychologie der HU Berlin federführend beteiligt…→Romantischer Gender-Gap
-
Facts & Events
 MPG © Hallbauer und Fioretti
Facts & EventsDie Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat der Berliner Spitzenforscherin Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier und der US-Amerikanerin…→
MPG © Hallbauer und Fioretti
Facts & EventsDie Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat der Berliner Spitzenforscherin Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier und der US-Amerikanerin…→Nobelpreis Chemie 2020 für Emmanuelle Charpentier – wir gratulieren!
-
Insights
 © Neurospace
InsightsDas Start-up Neurospace, steht wie kein anderes für die boomende „New Space“-Industrie in der Brain City Berlin. Im Interview: Irene Selvanathan,…→
© Neurospace
InsightsDas Start-up Neurospace, steht wie kein anderes für die boomende „New Space“-Industrie in der Brain City Berlin. Im Interview: Irene Selvanathan,…→„Wir wollen Wissenschaft und Industrie zum Mond bringen“
-
Facts & Events
 © mit:forschen!
Facts & EventsNoch bis zum 3. Juni können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen für den „Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen…→
© mit:forschen!
Facts & EventsNoch bis zum 3. Juni können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen für den „Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen…→Gesucht: Exzellente Publikationen zu bürgerwissenschaftlicher Forschung
-
Transfer – Stories
 David Ausserhofer/IGB
Transfer – StoriesBerlin ist eine der wasserreichsten Städte Deutschlands. Doch auch vor Havel, Spree und Wannsee macht der Klimawandel nicht halt. Am Leibniz-Institut…→
David Ausserhofer/IGB
Transfer – StoriesBerlin ist eine der wasserreichsten Städte Deutschlands. Doch auch vor Havel, Spree und Wannsee macht der Klimawandel nicht halt. Am Leibniz-Institut…→„Wir versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen“ | 04.07.2019
-
Insights Transfer – Stories
 © Felix Noak
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Dr. phil. Thorsten Philipp, Referent für Transdisziplinäre Lehre im Präsidium der Technischen Universität Berlin.→
© Felix Noak
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Dr. phil. Thorsten Philipp, Referent für Transdisziplinäre Lehre im Präsidium der Technischen Universität Berlin.→„Jeder weiß etwas“
-
Facts & Events
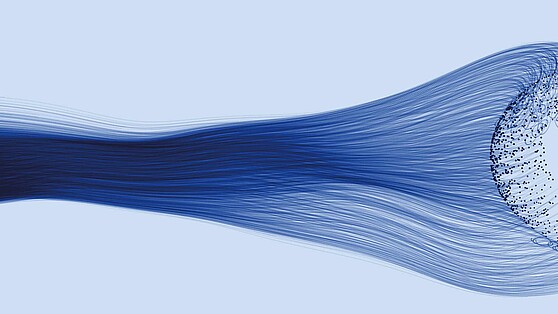 © LNDW
Facts & EventsDie LNDW feiert in diesem Jahr Jubiläum. Auf dem Programm stehen mehr als 1.000 Veranstaltungen. Tickets gibt’s zum Sonderpreis von 5 Euro!→
© LNDW
Facts & EventsDie LNDW feiert in diesem Jahr Jubiläum. Auf dem Programm stehen mehr als 1.000 Veranstaltungen. Tickets gibt’s zum Sonderpreis von 5 Euro!→25 Jahre Lange Nacht der Wissenschaften
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Agentur Medienlabor / Stefan Schubert
Facts & Events Transfer – StoriesFünf Unternehmen aus der Hauptstadtregion wurden für ihre visionären Ideen und Produkte ausgezeichnet, ein weiteres erhielt den Sonderpreis.→
© Agentur Medienlabor / Stefan Schubert
Facts & Events Transfer – StoriesFünf Unternehmen aus der Hauptstadtregion wurden für ihre visionären Ideen und Produkte ausgezeichnet, ein weiteres erhielt den Sonderpreis.→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025 – die Gewinner
-
Facts & Events
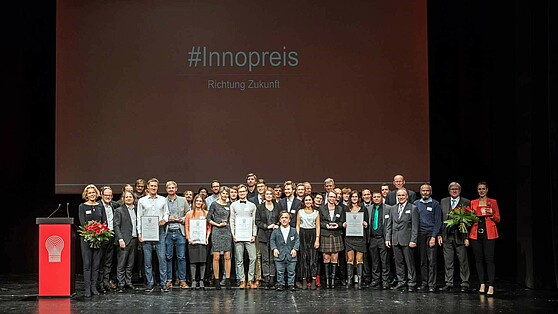 ©Paul Hahn Photography
Facts & EventsBerlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach haben den Startschuss gegeben für den…→
©Paul Hahn Photography
Facts & EventsBerlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach haben den Startschuss gegeben für den…→Innovationspreis 2020 – bis 22. Juni bewerben!
-
Facts & Events
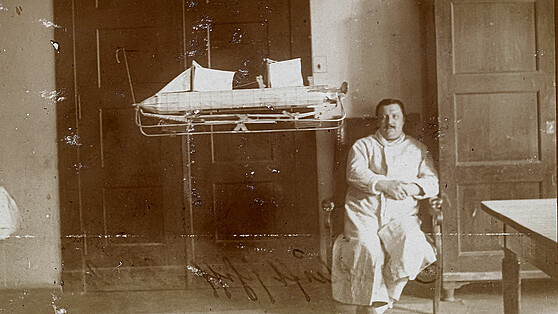 © Institut für Geschichte der Medizin und Ethik der Medizin, Charité (IGM-K-HPAC 3086-1908)
Facts & EventsIn der Ausstellung „Erfindungswahn!“ erzählt das Berliner Medizinhistorische Museum der Charité die Geschichte des „Ingenieurs von Tarden“ und seines…→
© Institut für Geschichte der Medizin und Ethik der Medizin, Charité (IGM-K-HPAC 3086-1908)
Facts & EventsIn der Ausstellung „Erfindungswahn!“ erzählt das Berliner Medizinhistorische Museum der Charité die Geschichte des „Ingenieurs von Tarden“ und seines…→Erfindungswahn – der Traum vom Fliegen
-
Insights Transfer – Stories
 © Ivar Veermae
Insights Transfer – StoriesAm Coworking Space EINS in Berlin-Charlottenburg fördert die TU Berlin Start-ups, die den globalen Herausforderungen gleich dreifach nachhaltig…→
© Ivar Veermae
Insights Transfer – StoriesAm Coworking Space EINS in Berlin-Charlottenburg fördert die TU Berlin Start-ups, die den globalen Herausforderungen gleich dreifach nachhaltig…→Ökonomisch, ökologisch, sozial
-
 ©vdo
Jedes Jahr kurz vor dem Fest stellen wir uns hoffnungsvoll die gleiche Frage: Gibt es eine Weiße Weihnacht? Nach Einschätzung des Vereins Berliner…→
©vdo
Jedes Jahr kurz vor dem Fest stellen wir uns hoffnungsvoll die gleiche Frage: Gibt es eine Weiße Weihnacht? Nach Einschätzung des Vereins Berliner…→Ob grün oder weiß: Wir wünschen Frohe Weihnachten!
-
Facts & Events
 Facts & EventsIm Rahmen der „Creative Cities Challenge“ sucht das Städte-Netzwerk „Global Innovation Collaborative“ innovative Lösungen, die zur wirtschaftlichen…→
Facts & EventsIm Rahmen der „Creative Cities Challenge“ sucht das Städte-Netzwerk „Global Innovation Collaborative“ innovative Lösungen, die zur wirtschaftlichen…→Verlängert bis 3. August: Wettbewerbs-Aufruf „Creative Cities Challenge 2021”
-
Facts & Events
 © Ilja C Hendel / Wissenschaft im Dialog
Facts & EventsEs ist wieder so weit: Das Ausstellungsschiff ist erneut auf deutschen Gewässern unterwegs. 29 Städte stehen in diesem Jahr auf dem Programm.→
© Ilja C Hendel / Wissenschaft im Dialog
Facts & EventsEs ist wieder so weit: Das Ausstellungsschiff ist erneut auf deutschen Gewässern unterwegs. 29 Städte stehen in diesem Jahr auf dem Programm.→Ahoi! MS Wissenschaft on Tour 2025
-
Transfer – Stories
 Foto: Mall Anders/Matthew Crabbe
Transfer – Stories„Mall Anders“ heißt ein offenes Lernlabor, das FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und Charité – Universitätsmedizin gemeinsam in einer Shopping Mall…→
Foto: Mall Anders/Matthew Crabbe
Transfer – Stories„Mall Anders“ heißt ein offenes Lernlabor, das FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und Charité – Universitätsmedizin gemeinsam in einer Shopping Mall…→Wissenschaft in der Shopping Mall
-
Facts & Events
 Matthias Heyde
Facts & EventsVor rund einem Jahr ging die Berlin University Alliance (BUA) im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern an den Start. Dem…→
Matthias Heyde
Facts & EventsVor rund einem Jahr ging die Berlin University Alliance (BUA) im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern an den Start. Dem…→1 Jahr Berlin University Alliance
-
Facts & Events
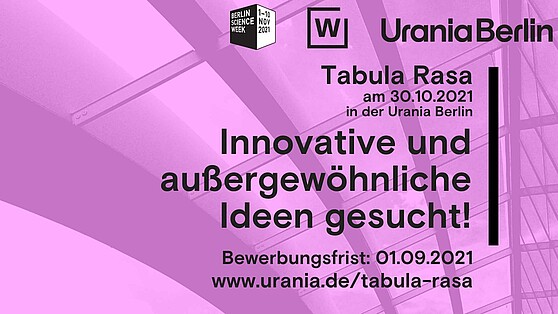 Facts & EventsMit der Wissenschaftsmesse „Tabula rasa – Wissenschaft zum Anfassen“ bietet die Urania Berlin 40 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein…→
Facts & EventsMit der Wissenschaftsmesse „Tabula rasa – Wissenschaft zum Anfassen“ bietet die Urania Berlin 40 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein…→Wettbewerb: innovative und kreative Ideen aus Wissenschaft und Forschung!
-
Facts & Events Transfer – Stories
 TU Berlin © Felix Noak
Facts & Events Transfer – StoriesNoch bis zum 29. April können interdisziplinäre Forschungsteams Proposals für die Next Grand Challenge der Berlin University Alliance einreichen.→
TU Berlin © Felix Noak
Facts & Events Transfer – StoriesNoch bis zum 29. April können interdisziplinäre Forschungsteams Proposals für die Next Grand Challenge der Berlin University Alliance einreichen.→Next Grand Challenge: jetzt bewerben!
-
Facts & Events
 © Frank Richtersmeier
Facts & EventsDen österliche Spaziergang mit einem guten Zweck verbinden: Unsere Citizen-Science-Favoriten für die Feiertage.→
© Frank Richtersmeier
Facts & EventsDen österliche Spaziergang mit einem guten Zweck verbinden: Unsere Citizen-Science-Favoriten für die Feiertage.→Meister Lampe und Schmetterlinge – zu Ostern die Natur erkunden!
-
Facts & Events
 © Agentur Medienlabor/Benjamin Maltry
Facts & EventsFünf Preise und eine Sonderauszeichnung vergab die Jury des Innovationspreises Berlin Brandenburg am vergangenen Freitag im Rahmen einer…→
© Agentur Medienlabor/Benjamin Maltry
Facts & EventsFünf Preise und eine Sonderauszeichnung vergab die Jury des Innovationspreises Berlin Brandenburg am vergangenen Freitag im Rahmen einer…→Innovationspreis Berlin Brandenburg: die Gewinner:innen 2022
-
 ©Wolf Lux
Brain City-Interview mit Ramona Pop, Berliner Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe zum Innovationspreis Berlin…→
©Wolf Lux
Brain City-Interview mit Ramona Pop, Berliner Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe zum Innovationspreis Berlin…→„Berlin ist Innovationsstadt“
-
Insights Transfer – Stories
 © BettaF!sh/Valentin Pellio
Insights Transfer – StoriesDas Start-up BettaF!sh entwickelt und produziert in der Brain City Berlin die weltweit ersten authentischen Fischalternativen auf Meeresalgenbasis.→
© BettaF!sh/Valentin Pellio
Insights Transfer – StoriesDas Start-up BettaF!sh entwickelt und produziert in der Brain City Berlin die weltweit ersten authentischen Fischalternativen auf Meeresalgenbasis.→„Mit allem, was wir tun, betreten wir Neuland“
-
Transfer – Stories
 Foto: privat
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Dr. Anna Klippstein, Professorin für Finanzen, und Eliyahu Mätzschker, Student am Touro College Berlin.→
Foto: privat
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Dr. Anna Klippstein, Professorin für Finanzen, und Eliyahu Mätzschker, Student am Touro College Berlin.→Der Einfluss der Pandemie auf den Kapitalmarkt
-
Facts & Events
 © David Ausserhofer
Facts & EventsDer Nachwuchspreis ging an Dr. Anja Maria Wagemans – und damit ebenfalls an eine Forscherin der TU Berlin.→
© David Ausserhofer
Facts & EventsDer Nachwuchspreis ging an Dr. Anja Maria Wagemans – und damit ebenfalls an eine Forscherin der TU Berlin.→TU-Professorin Dr. Bénédicte Savoy erhält Berliner Wissenschaftspreis
-
Facts & Events
 the climate reality project/usplash
Facts & EventsBereits zum dritten Mal findet in der Brain City Berlin die internationale Konferenz „I, Scientist“ statt. Vom 20. bis 21. September 2019 kommen…→
the climate reality project/usplash
Facts & EventsBereits zum dritten Mal findet in der Brain City Berlin die internationale Konferenz „I, Scientist“ statt. Vom 20. bis 21. September 2019 kommen…→Jetzt anmelden! „I, Scientist“ – Genderkonferenz für Wissenschaftler*innen | 25.07.2019
-
Facts & Events
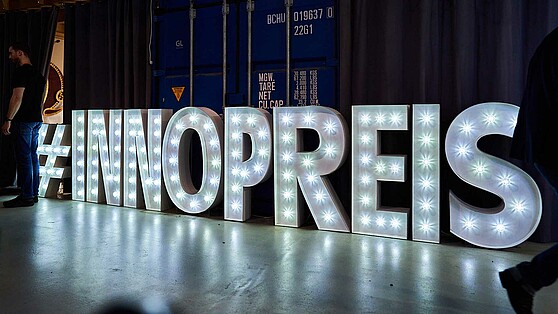 © Agentur Medienlabor / Stefan Schubert
Facts & EventsGesucht werden auch in diesem Jahr Produkte, Konzepte und Lösungen, die für die Innovationskraft der Hauptstadtregion stehen.→
© Agentur Medienlabor / Stefan Schubert
Facts & EventsGesucht werden auch in diesem Jahr Produkte, Konzepte und Lösungen, die für die Innovationskraft der Hauptstadtregion stehen.→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025: bis 14. Juli bewerben!
-
Facts & Events
 Prof. Dr. Volker Haucke: FMP © Silke Oßwald; Prof. Dr. Ana Prombo: MDC © Pablo Castagnola
Facts & EventsProf. Dr. Ana Pombo (MDC) and Prof. Dr. Volker Haucke (FMP) haben den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2025 erhalten.→
Prof. Dr. Volker Haucke: FMP © Silke Oßwald; Prof. Dr. Ana Prombo: MDC © Pablo Castagnola
Facts & EventsProf. Dr. Ana Pombo (MDC) and Prof. Dr. Volker Haucke (FMP) haben den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2025 erhalten.→Leibniz-Preis für 2 Berliner Spitzenforschende
-
Facts & Events
 Foto: Gary Bendig/Unsplash
Facts & EventsFotos vom Osterhasen gesucht! Ein Citizen Science-Projekt ruft die Berlinerinnen und Berliner dazu auf, Hasen, Kaninchen und Füchse im Stadtgebiet zu…→
Foto: Gary Bendig/Unsplash
Facts & EventsFotos vom Osterhasen gesucht! Ein Citizen Science-Projekt ruft die Berlinerinnen und Berliner dazu auf, Hasen, Kaninchen und Füchse im Stadtgebiet zu…→Stalk den Hasen
-
Facts & Events
 Foto: Michael Kompe @ HWR Berlin
Facts & EventsDer Verbundantrag von fünf Berliner Hochschulen und ein Antrag der ASH Berlin zur Förderung im Rahmen der bundesweiten Initiative sind bewilligt.→
Foto: Michael Kompe @ HWR Berlin
Facts & EventsDer Verbundantrag von fünf Berliner Hochschulen und ein Antrag der ASH Berlin zur Förderung im Rahmen der bundesweiten Initiative sind bewilligt.→Förderprogramm „Innovative Hochschule“: 2 Berliner Anträge erfolgreich
-
Facts & Events
 © DLR. Alle Rechte vorbehalten
Facts & EventsIm „DLR_School_LAB Online Observatory“ können Schülerinnen und Schüler jetzt deutschlandweit die Sonne live beobachten.→
© DLR. Alle Rechte vorbehalten
Facts & EventsIm „DLR_School_LAB Online Observatory“ können Schülerinnen und Schüler jetzt deutschlandweit die Sonne live beobachten.→Im Klassenzimmer zur Sonne reisen
-
Facts & Events
 © Max Delbrück Center / Stefanie Loos
Facts & EventsAm Abend des 22. Juni präsentiert sich die Brain City Berlin wieder in ihrer ganzen Vielfalt. Das Motto der LNDW 2024: „Erleben. Verstehen. Wissen.“→
© Max Delbrück Center / Stefanie Loos
Facts & EventsAm Abend des 22. Juni präsentiert sich die Brain City Berlin wieder in ihrer ganzen Vielfalt. Das Motto der LNDW 2024: „Erleben. Verstehen. Wissen.“→Lange Nacht der Wissenschaften 2024
-
Transfer – Stories
 Foto: Olga Makarova privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Dr. Olga Makarova über ihre Forschung während der Pandemie – und den Bedarf der Gesellschaft an mikrobiologischem Wissen.→
Foto: Olga Makarova privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Dr. Olga Makarova über ihre Forschung während der Pandemie – und den Bedarf der Gesellschaft an mikrobiologischem Wissen.→Gastbeitrag: COVID-19 und mikrobiologisches Wissen
-
Facts & Events
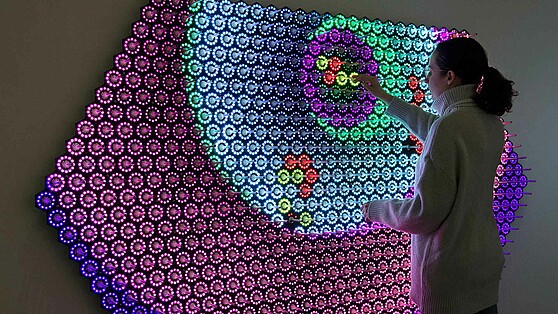 © Robin Baumgarten
Facts & EventsAm 14. April feiert die Urania Berlin den World Quantum Day – und damit 100 Jahre Quantenphysik. Veranstalterin ist die Deutsche Physikalische…→
© Robin Baumgarten
Facts & EventsAm 14. April feiert die Urania Berlin den World Quantum Day – und damit 100 Jahre Quantenphysik. Veranstalterin ist die Deutsche Physikalische…→World Quantum Day 2025: Quantenforschung zum Mitmachen
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Facts & Events Transfer – StoriesDie Brain City Berlin hat ein neues Gründerzentrum: Der BerlinBioCube auf dem Campus Berlin-Buch umfasst 8.000 Quadratmeter moderne Labor- und…→
© Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Facts & Events Transfer – StoriesDie Brain City Berlin hat ein neues Gründerzentrum: Der BerlinBioCube auf dem Campus Berlin-Buch umfasst 8.000 Quadratmeter moderne Labor- und…→BerlinBioCube eröffnet
-
Facts & Events
 Fotocredit: #MIT Covid-19 Challenge
Facts & EventsExpert*innen unterschiedlichster Fachrichtungen können sich noch bis zum 26. Mai für den zweiten Hackathon „Beat the Pandemic“ bewerben. Ziel des…→
Fotocredit: #MIT Covid-19 Challenge
Facts & EventsExpert*innen unterschiedlichster Fachrichtungen können sich noch bis zum 26. Mai für den zweiten Hackathon „Beat the Pandemic“ bewerben. Ziel des…→Teilnehmer*innen gesucht: MIT-Hackathon „Beat the Pandemic II“
-
Transfer – Stories
 Credit: Alexander Rentsch/HTW Berlin
Transfer – StoriesProf. Dr. Florian Koch bringt als Experte für Stadtentwicklung und Smart Cities an der HTW Berlin in seiner Forschung Wissenschaft, Wirtschaft und…→
Credit: Alexander Rentsch/HTW Berlin
Transfer – StoriesProf. Dr. Florian Koch bringt als Experte für Stadtentwicklung und Smart Cities an der HTW Berlin in seiner Forschung Wissenschaft, Wirtschaft und…→„Die zunehmende Urbanisierung bietet auch Chancen“
-
Transfer – Stories
 Transfer – StoriesDass die Raumfahrt eine Revolution in der Kommerzialisierung erfährt, dürfte dank Firmen wie Elon Musks SpaceX bekannt sein. Doch ist auch bekannt,…→
Transfer – StoriesDass die Raumfahrt eine Revolution in der Kommerzialisierung erfährt, dürfte dank Firmen wie Elon Musks SpaceX bekannt sein. Doch ist auch bekannt,…→Von Berlin zum Mond: Die Berliner Raumfahrt-Szene boomt | 03.09.2018
-
Facts & Events
 Fu Berlin / Peter Hirnsel
Facts & EventsBerlin ist eine weltoffene Metropole. Menschen aus über 190 Nationen leben und arbeiten in der Stadt. Und auch immer mehr junge Talente zieht es nach…→
Fu Berlin / Peter Hirnsel
Facts & EventsBerlin ist eine weltoffene Metropole. Menschen aus über 190 Nationen leben und arbeiten in der Stadt. Und auch immer mehr junge Talente zieht es nach…→Berliner Hochschulen besonders international | 10.10.2019
-
Facts & Events
 Credit: Tag der Deutschen Einheit Halle (Saale)
Facts & EventsAm 3. Oktober ist die Brain City Berlin mit dem „Berlin-Cube“ auf der EinheitsEXPO in Halle (Saale) vor Ort.→
Credit: Tag der Deutschen Einheit Halle (Saale)
Facts & EventsAm 3. Oktober ist die Brain City Berlin mit dem „Berlin-Cube“ auf der EinheitsEXPO in Halle (Saale) vor Ort.→#BRAINCITYBERLIN auf dem Tag der Deutschen Einheit
-
Transfer – Stories
 Foto: André Bakker
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg, Professorin für Internationale BWL an der SRH Berlin University of…→
Foto: André Bakker
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg, Professorin für Internationale BWL an der SRH Berlin University of…→Zugang zur Digitalität finden
-
Facts & Events
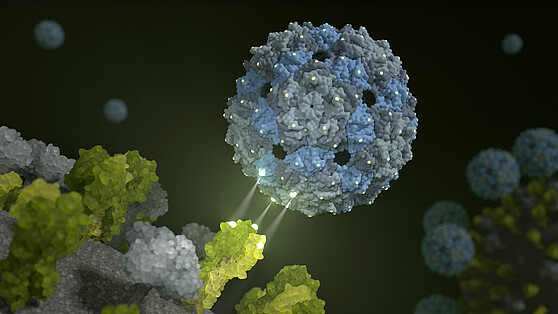 ©FMP/ Barth van Rossum
Facts & EventsMit Viren gegen Influenza, Vogelgrippe – und bald vielleicht auch gegen Corona? Eine Allianz von Wissenschaftler*innen des Leibniz Forschungsinstituts…→
©FMP/ Barth van Rossum
Facts & EventsMit Viren gegen Influenza, Vogelgrippe – und bald vielleicht auch gegen Corona? Eine Allianz von Wissenschaftler*innen des Leibniz Forschungsinstituts…→Berliner Forscher*innen-Allianz entwickelt Influenza-Hemmstoff
-
Facts & Events
 ©Berlin Science Week 2019
Facts & Events23.10.2019 | Über 350 Spitzenforscher*innen aus aller Welt, mehr als 130 Veranstaltungen und ein neues Format: der „Berlin Science Campus“. Die Berlin…→
©Berlin Science Week 2019
Facts & Events23.10.2019 | Über 350 Spitzenforscher*innen aus aller Welt, mehr als 130 Veranstaltungen und ein neues Format: der „Berlin Science Campus“. Die Berlin…→10 Tage Wissenschaft pur: Berlin Science Week 2019
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesAuf der vierten Transfer Week Berlin-Brandenburg vom 25. bis zum 29. November geht um neueste Entwicklungen im regionalen Transfergeschehen. 62…→
© Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesAuf der vierten Transfer Week Berlin-Brandenburg vom 25. bis zum 29. November geht um neueste Entwicklungen im regionalen Transfergeschehen. 62…→Zukunft des Wissenstransfers: Transfer Week 2024
-
Transfer – Stories
 © hj barraza/Unsplash
Transfer – StoriesUnsere Gastautorin Dr. Barbara Schäuble, Professorin für„Diversitätsbewusste Ansätze in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit“ an der Alice Salomon…→
© hj barraza/Unsplash
Transfer – StoriesUnsere Gastautorin Dr. Barbara Schäuble, Professorin für„Diversitätsbewusste Ansätze in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit“ an der Alice Salomon…→Gastbeitrag: Ein plötzlicher Kurswechsel – Präsenzblöcke ins Netz verlegen
-
Facts & Events
 Foto: © Falling Walls Foundation
Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften oder die Rückkehr von Saurier-Star Tristan Otto nach Berlin: Auch in diesem Jahr bietet der…→
Foto: © Falling Walls Foundation
Facts & EventsOb Berlin Science Week, Lange Nacht der Wissenschaften oder die Rückkehr von Saurier-Star Tristan Otto nach Berlin: Auch in diesem Jahr bietet der…→Brain City-Highlights 2022: unsere Top 10
-
Facts & Events
 chris knight/unsplash
Facts & EventsBerliner*innen mit ausländischen Wurzeln sind ausgesprochen innovativ. Laut einem Kurzbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liegt der…→
chris knight/unsplash
Facts & EventsBerliner*innen mit ausländischen Wurzeln sind ausgesprochen innovativ. Laut einem Kurzbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liegt der…→Berliner*innen mit Migrationshintergrund besonders patent | 29.05.2019
-
Transfer – Stories
 ©Matthias Picket
Transfer – StoriesDr. Anne Schreiter, Geschäftsführerin der German Scholars Organization (GSO), verrät im Brain City-Interview, welche alternativen…→
©Matthias Picket
Transfer – StoriesDr. Anne Schreiter, Geschäftsführerin der German Scholars Organization (GSO), verrät im Brain City-Interview, welche alternativen…→„Wissenschaft bedeutet nicht nur Forschung“
-
Stories categories Facts & Events
 © Berliner Partner. Urheber: Eventfotografen Berlin
Stories categories Facts & EventsAusblick: Das wird 2026 in der Berliner Wissenschaft wichtig.→
© Berliner Partner. Urheber: Eventfotografen Berlin
Stories categories Facts & EventsAusblick: Das wird 2026 in der Berliner Wissenschaft wichtig.→Ausblick: Das wird 2026 in der Berliner Wissenschaft wichtig
-
Facts & Events
 ©Shutterstock/4 PM Production
Facts & EventsÜber akademische und nicht-akademische Karriere-Perspektiven informiert vom 22. bis 25. August 2022 eine Veranstaltung an der TU Berlin.→
©Shutterstock/4 PM Production
Facts & EventsÜber akademische und nicht-akademische Karriere-Perspektiven informiert vom 22. bis 25. August 2022 eine Veranstaltung an der TU Berlin.→Career Week for International Junior Researchers – bis 19. August anmelden!
-
Facts & Events
 ©IFAF
Facts & Events22.11.2019 | Interdisziplinarität ist ein Charakteristikum der Berliner Wissenschaft. Das bewies zuletzt die Verleihung des Titels „Exzellenz-…→
©IFAF
Facts & Events22.11.2019 | Interdisziplinarität ist ein Charakteristikum der Berliner Wissenschaft. Das bewies zuletzt die Verleihung des Titels „Exzellenz-…→10 Jahre IFAF – herzlichen Glückwunsch!