-

© HTW Berlin/Alexander Rentsch
30.10.2025„Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“
Im Januar 2025 ist die European University Alliance EUonAIR an den Start gegangen. 14 Universitäten und Hochschulen haben sich in dem europäischen Forschungs- und Wissenschaftsverbund zusammengetan, um durch innovative Lern-, Forschungs- und Arbeitsmethoden das Thema Künstliche Intelligenz in Lehre, Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Der Verbund arbeitet außerdem an zukunftsfähigen smarten Lösungen für Städte. EUonAIR wird im Rahmen der Leuchtturm-Initiative European Universities 2024 über einen Zeitraum von vier Jahren mit insgesamt 14,4 Millionen Euro gefördert. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) ist als einzige Berliner Hochschule dabei. Mehr über den aktuellen Umsetzungsstand von EUonAIR und die Rolle der HTW Berlin in der europäischen Allianz erzählt Brain City Botschafter Prof. Dr. Florian Koch, Sprecher des Forschungsclusters „Sustainable Smart Cities“ an der HTW Berlin.
Herr Prof. Dr. Koch, Zielsetzung des Verbunds EUonAIR ist es, das Thema Künstliche Intelligenz in Lehre, Wirtschaft und in Gesellschaft zu stärken. Ein hoher Anspruch …
Man kann ihn eigentlich nicht komplett erfüllen. Deshalb haben wir uns überlegt: Welchen Mehrwert kann die HTW Berlin als Hochschule in den Verbund einbringen? Unsere Studierenden wenden Künstliche Intelligenz ja bereits an und werden KI künftig auch im Berufsleben brauchen. Die Frage ist: Wie reagieren wir als Hochschule darauf? Wir wollen ja nicht alle Studierenden zu Informatikerinnen und Informatikern ausbilden, aber eine KI-Grundkompetenz ist inzwischen in allen Studiengängen wichtig. Ansatz von EUonAIR ist zu überlegen, wie KI in die Lehre integriert werden kann. Das ist zugleich der Aufgabenbereich, den die HTW Berlin in dem Verbundprojekt übernommen hat. Wir schauen uns beispielsweise an, welche Angebote zur Vermittlung von KI es bereits gibt und ob sich darüber auch offene Lehrmaterialien, sogenannte Open Educational Resources, entwickeln lassen. Das testen wir dann in Lehrveranstaltungen aus und hoffen, die Materialien dann auch gleich in der Lehre anwenden zu können.
Es gibt also eine Aufgabenverteilung innerhalb der Allianz. Welche Hochschule verantwortet was?
Die Kozminski University in Warschau hat die Projektsteuerung übernommen. Das Warschauer Team ist im Rahmen von EUonAIR auch verantwortlich für den Aufbau des virtuellen Campus „MyAI University“. Auf dieser Plattform sollen später sämtliche Angebote von EUonAIR zu finden sein. Die Luxembourg School of Business ist zuständig für die Kommunikation. Wir kooperieren eng mit der privaten Universitat Abat Oliba CEU in Barcelona, die vor allem für das Thema Smart City verantwortlich ist. Insofern hat jeder Partner einen Hauptzuständigkeitsbereich. Die Grundidee ist allerdings, dass alle an allem mitwirken.
Eine weitere Zielsetzung von EUonAIR ist es, innovative Mobilitätslösungen zu entwickeln und umzusetzen. Inwiefern betrifft das die HTW Berlin?
Das Thema Mobility betreut die Kozminski University in Polen, aber auch Hochschulen aus Litauen oder der Ukraine sind involviert. Hier geht es darum, wie man attraktive Bedingungen für Fachkräfte schaffen kann, die beispielsweise in England, Deutschland oder Frankreich ausgebildet worden sind, um sie in den heimischen Arbeitsmarkt zurückzuholen. Für Deutschland ist dieses Thema nicht so relevant. Spannend für uns als HTW Berlin ist es allerdings zu erforschen, wie Studierende internationale Erfahrung machen können, denen das Geld für Auslandssemester fehlt oder die aus anderen Gründen an den Ort gebunden sind. So etwas ließe sich beispielsweise über einen internationalen Online-Austausch organisieren.
Sie erwähnten bereits die zentrale Plattform des Verbunds, „MyAI University“. Was wird darauf passieren?
MyAI University wird sämtliche Aktivitäten von EUonAIR immersiv integrieren. Ganz lustig ist: Die Gebäude der einzelnen Partnerhochschulen werden auf dem Campus nachgebildet, so dass man sie virtuell betreten und dort auch Kurs belegen kann. Es wird auch Avatare von einigen Professorinnen und Professoren geben, die Inhalte dann in allen Sprachen vermitteln können. Das entsteht jetzt gerade. Es sind aber noch keine Lehrinhalte auf der Plattform hinterlegt.
Welche Zielsetzung hat EUonAIR über die Förderung von KI in der Bildung hinaus? Die Webseite listet verschiedene Ansätze.
Ein solches Ziel ist beispielsweise im Bereich Mobilität, dass künftig 50 Prozent aller Studierenden internationale Erfahrungen gesammelt haben. Wir streben daher eine gewisse Anzahl an offenen Kursen an. Diese sollen als Open Educational Resources frei zugänglich sein. Und wir wollen im Bereich Smart Cities, der ja mein Kernthema ist, sogenannte Smart University Labs gründen. Wo genau, das steht noch nicht fest und hängt davon ab, welchen Mehrwert die jeweilige Partnerhochschule der sie umgebende Stadt bietet.
Werden diese Labs offen für die Zivilgesellschaft sein?
Wir verfolgen hier zwei unterschiedliche Ansätze: Einerseits schauen wir uns an, welche Labs bereits in der Stadt existieren. In Berlin gibt es beispielsweise schon das CityLAB Berlin oder die auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel entstehende Urban Tech Republic. Das heißt, wir müssen hier das Rad nicht neu erfinden, sondern sondieren eher, welche Kooperationsmöglichkeiten es in Berlin bereits gibt. Zum anderen wollen wir physische oder virtuelle Räume schaffen, in denen wir Forschung über KI vermitteln können. Diese werden offen sein für die Zivilgesellschaft. Auch Unternehmen können sich mit Ideen an uns wenden, die sie zusammen mit den Studierenden umsetzen möchten.
Gibt es an der HTW bereits konkrete Umsetzungsbeispiel?
Wir haben zunächst eine Bestandsaufnahme für Berlin gemacht und in der HTW Berlin dann einen physischen Raum eingerichtet. Dort möchten wir unseren Studierenden vermitteln, was es im Bereich Smart City in Berlin bereits gibt und wo sich Möglichkeiten auftun. Zusätzlich haben wir technische Instrumente vor Ort, anhand derer wir den Studierenden konkret zeigen können, wie sie funktionieren und angewandt werden. Ein Beispiel sind Sensoren, die den Verkehr oder Hitze messen und visualisieren. Thematisch sind wir relativ breit aufgestellt. In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) veranstalten wir demnächst einen Hackathon. Da geht es um das Querschnittsthema Datennutzung. Was wir im kommenden Jahr machen werden, ist noch offen. Aktuell sind wir mit einem Berliner Wohnungsbauunternehmen im Gespräch, um zusammen einen Hackathon für 2026 zu organisieren.
Im Prinzip geht es in den Labs also um Ermöglichung?
Genau. Wie gesagt, wir wollen das Rad nicht neu erfinden und auch schauen, was Berliner Unternehmen im Idealfall schon anbieten, um ein konkretes Problem zu lösen. Die meisten Smart-City-Tools haben inzwischen einen KI-Anteil.
Wie ist die Universitat Abat Oliba in Barcelona als Leiterin des Bereichs Smart City in die Labs eingebunden?
Barcelona hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Labs miteinander zu vernetzen. Es gibt bisher eins in Barcelona, eins in Paris und eins bei uns in Berlin. Eine Idee ist, dass die Gewinner-Mannschaften der diesjährigen Hackathons in Paris, Barcelona und Berlin 2026 gemeinsam zur Smart City Expo nach Barcelona fahren und dort noch einmal prämiert werden. Der Mehrwert entsteht durch den internationalen Austausch.
Welche Vorteile bietet Berlin der Allianz EUonAIR bzw. warum ist die HTW Berlin als eine von zwei deutschen Hochschulen – neben der Hochschule Heilbronn – dabei?
Einerseits passiert in Berlin schon relativ viel im Bereich Smart City. Wie gesagt, wir haben hier bereits Labs mit spezieller Ausrichtung, die sowohl zivilgesellschaftlich orientiert als auch mit den besonderen Herausforderungen Berlins verbunden sind. Darüber hinaus gibt es in Berlin ein großes Smart-City-Ökosystem mit vielen Akteurinnen und Akteuren, darunter viele innovative Start-ups und Unternehmen. In Berlin stellt sich also weniger die Frage, wo man anfängt, sondern eher, wie das alles zusammengebracht werden kann. Was es in Berlin allerdings noch nicht gibt, ist ein Link zur Lehre. Es existiert kein Smart-City-Studiengang in Berlin. Lediglich einzelne Module oder das von mir betreute Forschungscluster „Sustainable Smart Cities“. EUonAIR bietet der HTW Berlin die spannende Möglichkeit, sich als Hochschule zukunftsfähig aufzustellen. Wir können darüber austesten, was wir künftig wie in die Lehre reinbringen müssen. Diese Erfahrungen möchten wir dann auch anderen zugänglich machen. Das ist die Idee dahinter.
Interview: Ernestine von der Osten-Sacken
Mehr Stories
-
Insights Facts & Events
 © Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin
Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→
© Bundespreis Ecodesign. Urheber/in: IDZ Berlin
Insights Facts & Events„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin.→„Mach Moor – Design mit Paludikultur“: Ausstellung zum Moorschutz in Berlin
-
Insights Transfer – Stories
 © Nikolaus Brade
Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→
© Nikolaus Brade
Insights Transfer – StoriesMit dem Projekt „Multisensory in Dialogue and Artistic Practice“ setzen die UdK Berlin und die Folkwang ein starkes Zeichen für die Zukunft der…→Gemeinsames Potenzial entfalten
-
Transfer – Stories
 © shutterstock/ Studio Romantic
Transfer – StoriesKönnen pflegebedürftige Menschen durch gezielte Bewegung wieder selbständiger werden? Das hat Brain City Botschafter Prof. Dr. Uwe Bettig im Projekt…→
© shutterstock/ Studio Romantic
Transfer – StoriesKönnen pflegebedürftige Menschen durch gezielte Bewegung wieder selbständiger werden? Das hat Brain City Botschafter Prof. Dr. Uwe Bettig im Projekt…→Wieder fit für daheim
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Agentur Medienlabor / Stefan Schubert
Facts & Events Transfer – StoriesFünf Unternehmen aus der Hauptstadtregion wurden für ihre visionären Ideen und Produkte ausgezeichnet, ein weiteres erhielt den Sonderpreis.→
© Agentur Medienlabor / Stefan Schubert
Facts & Events Transfer – StoriesFünf Unternehmen aus der Hauptstadtregion wurden für ihre visionären Ideen und Produkte ausgezeichnet, ein weiteres erhielt den Sonderpreis.→Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025 – die Gewinner
-
Insights Transfer – Stories
 © TU Berlin/Felix Noak
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Giuseppe Caire forscht an der TU Berlin an einer neuen Übertragungsmethode, die drahtlose Kommunikation revolutionieren könnte.→
© TU Berlin/Felix Noak
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Giuseppe Caire forscht an der TU Berlin an einer neuen Übertragungsmethode, die drahtlose Kommunikation revolutionieren könnte.→Drahtlose Kommunikation völlig neu gedacht
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Christian Kielmann
Facts & Events Transfer – StoriesAuf dem Campus der TU Berlin entsteht die europaweit größte Laborinfrastruktur für Transferteams im Bereich der Grünen Chemie. Die „Chemical Invention…→
© Christian Kielmann
Facts & Events Transfer – StoriesAuf dem Campus der TU Berlin entsteht die europaweit größte Laborinfrastruktur für Transferteams im Bereich der Grünen Chemie. Die „Chemical Invention…→Spatenstich für „Chemical Invention Factory“
-
Insights
 © WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner
InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→
© WISTA.Plan GmbH / Dirk Laubner
InsightsWie lässt sich der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof klimaresilient aufstellen? Das erforscht die WISTA Management GmbH aktuell in einem…→Blaupause für Zukunft
-
Insights Facts & Events
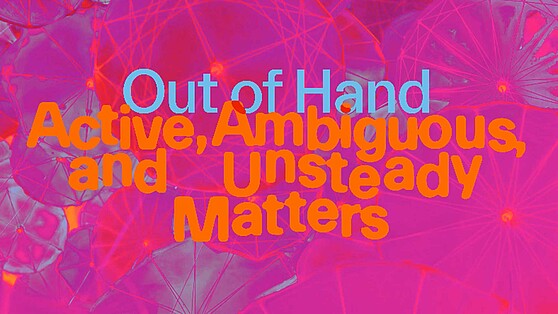 © Matters of Activity / HU Berlin
Insights Facts & EventsAm 19. September veranstaltet das Exzellenzcluster „Matters of Activity" seine Jahreskonferenz. Brain City Interview mit Dr. Christian Stein.→
© Matters of Activity / HU Berlin
Insights Facts & EventsAm 19. September veranstaltet das Exzellenzcluster „Matters of Activity" seine Jahreskonferenz. Brain City Interview mit Dr. Christian Stein.→„Wir bringen das Material auf Augenhöhe“
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Tu Berlin / allefarben-foto
Facts & Events Transfer – StoriesDrohnen-Logistik, Baustoff-Recycling und Wiederverwendung von Abwasser: Diese drei Ideen sollen in den kommenden drei Jahren in Reallaboren praxisnah…→
© Tu Berlin / allefarben-foto
Facts & Events Transfer – StoriesDrohnen-Logistik, Baustoff-Recycling und Wiederverwendung von Abwasser: Diese drei Ideen sollen in den kommenden drei Jahren in Reallaboren praxisnah…→Drei Berliner Reallabore gehen an den Start
-
Insights
 © Jens Freudenberg
InsightsInterview mit Prof. Cordula Endter, Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen…→
© Jens Freudenberg
InsightsInterview mit Prof. Cordula Endter, Professorin für Soziale Arbeit in der digitalisierten Gesellschaft an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen…→Weitaus mehr als Bedarfsanalysen – Co-Creation
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Stefan Klenke / HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→
© Stefan Klenke / HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDer Berliner Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm ist mit dem Wissenschaftspreis 2024 des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ausgezeichnet…→Berliner Wissenschaftspreis für Prof. Dr. Philipp Adelhelm
-
Insights Facts & Events
 © Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Facts & EventsEs geht um die Ernährung der Zukunft: Im Verbundprojekt CUBES Circle erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie etablierte…→
© Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Facts & EventsEs geht um die Ernährung der Zukunft: Im Verbundprojekt CUBES Circle erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie etablierte…→Tomaten und Fische im Zero-Waste-Kreislauf
-
Insights Transfer – Stories
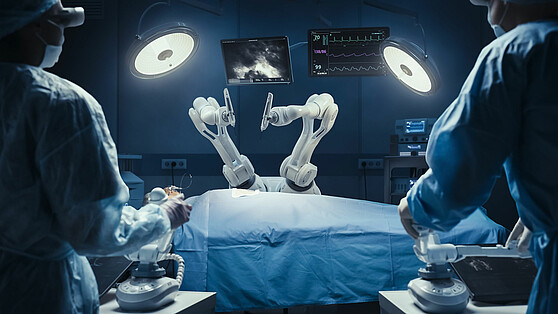 © Gorodenkoff / Shutterstock.com
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→
© Gorodenkoff / Shutterstock.com
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview: Prof. Dr. Petra Ritter, Koordinatorin des Projekts TEF-Health erzählt mehr über die länderübergreifende Test- und…→Europäische Testinfrastruktur für KI im Gesundheitswesen
-
Insights Transfer – Stories
 © HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→
© HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDie KI-Werkstatt der HTW Berlin bündelt die Kompetenzen der Hochschule interdisziplinär, um den Einsatz von KI praxisnah zu erforschen.→Generative KI in Forschung und Lehre stärken
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→
© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
Facts & Events Transfer – StoriesMit dem Anfang Mai gegründeten Institut bündelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Adlershof seine Expertise auf dem Gebiet der…→Neues DLR-Institut für Weltraumforschung
-
Startup Transfer – Stories
 © theion
Startup Transfer – StoriesDas Start-up theion will in der Brain City Berlin mit einer neuen Technologie den Batteriemarkt revolutionieren und die Energiewende beschleunigen.→
© theion
Startup Transfer – StoriesDas Start-up theion will in der Brain City Berlin mit einer neuen Technologie den Batteriemarkt revolutionieren und die Energiewende beschleunigen.→„Batterien made in Germany, made in Berlin”
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin University Alliance / Stefan Klenke
Insights Transfer – StoriesMit dem innovate! lab will die Berlin University Alliance Spitzenforschung schnell und zielgerichtet in die Praxis bringen. BUA-Geschäftsführerin Dr.…→
© Berlin University Alliance / Stefan Klenke
Insights Transfer – StoriesMit dem innovate! lab will die Berlin University Alliance Spitzenforschung schnell und zielgerichtet in die Praxis bringen. BUA-Geschäftsführerin Dr.…→„Forschungstransfer durch Agilität“
-
Insights
 © FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University
InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→
© FlorianWehde / Unsplash; JohnCairns /Oxford-University
InsightsDie Oxford Berlin Research Partnership bringt Spitzenforschende zusammen und fördert gezielt talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs.→Brücken schlagen zwischen Oxford und Berlin
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Berlin Partner / eventfotografen.berlin
Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→
© Berlin Partner / eventfotografen.berlin
Facts & Events Transfer – StoriesAnfang März haben insgesamt 19 Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen die Satzung von UNITE Sciences e.V.…→UNITE Sciences: Technologietransfer beschleunigen
-
Insights Innovationen
 © Berlin Institute for Innovation
Insights Innovationen„Innovation = Invention + Marktdurchdringung“, so die Arbeitsformel des Berlin Institute for Innovation. Wissenschaftlich fundiert betrachtet das BIFI…→
© Berlin Institute for Innovation
Insights Innovationen„Innovation = Invention + Marktdurchdringung“, so die Arbeitsformel des Berlin Institute for Innovation. Wissenschaftlich fundiert betrachtet das BIFI…→Die Forschungsmanufaktur
-
Facts & Events Transfer – Stories
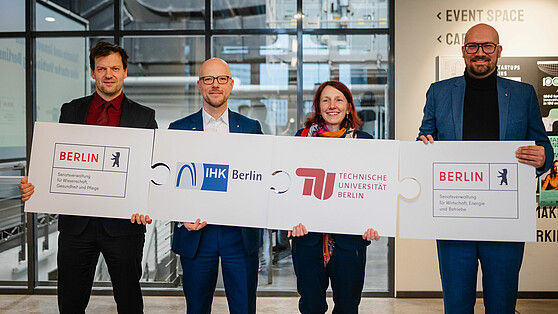 © IHK Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→
© IHK Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesHochschulausgründungen und Innovationen wollen TU Berlin und IHK Berlin künftig gemeinsam stärker voranbringen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde…→Kooperation zwischen TU Berlin und IHK Berlin
-
Insights Transfer – Stories
 © BettaF!sh/Valentin Pellio
Insights Transfer – StoriesDas Start-up BettaF!sh entwickelt und produziert in der Brain City Berlin die weltweit ersten authentischen Fischalternativen auf Meeresalgenbasis.→
© BettaF!sh/Valentin Pellio
Insights Transfer – StoriesDas Start-up BettaF!sh entwickelt und produziert in der Brain City Berlin die weltweit ersten authentischen Fischalternativen auf Meeresalgenbasis.→„Mit allem, was wir tun, betreten wir Neuland“
-
Insights
 © Ernestine von der Osten-Sacken
InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→
© Ernestine von der Osten-Sacken
InsightsAlle Jahre wieder locken zum Weihnachtsfest süße Leckereien. Warum können wir ihnen nicht widerstehen? Prof. Dr. Soyoung Q Park weiß mehr darüber.→Weihnachtsessen: bitte keine Überraschungen!
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin Partner/Eventfotografen
Insights Transfer – StoriesDie Forschungslandschaft in Berlin und Brandenburg ist hervorragend, aber recht fragmentiert. Das Konsortium UNITE will das ändern.→
© Berlin Partner/Eventfotografen
Insights Transfer – StoriesDie Forschungslandschaft in Berlin und Brandenburg ist hervorragend, aber recht fragmentiert. Das Konsortium UNITE will das ändern.→UNITE: Synergien fördern, Innovationen beschleunigen
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesAuf der vierten Transfer Week Berlin-Brandenburg vom 25. bis zum 29. November geht um neueste Entwicklungen im regionalen Transfergeschehen. 62…→
© Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesAuf der vierten Transfer Week Berlin-Brandenburg vom 25. bis zum 29. November geht um neueste Entwicklungen im regionalen Transfergeschehen. 62…→Zukunft des Wissenstransfers: Transfer Week 2024
-
Insights Transfer – Stories
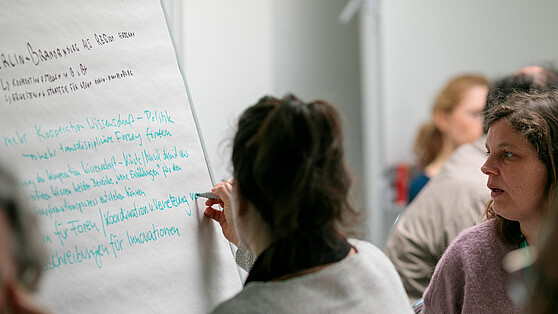 CCC © Michael Reinhardt
Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→
CCC © Michael Reinhardt
Insights Transfer – StoriesIm Brain City Interview: Dr. Anita Dame, Geschäftsführerin des Climate Change Center Berlin Brandenburg.→„Klimatransformation ist ein Marathon“
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © CeRRI 2024
Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→
© CeRRI 2024
Facts & Events Transfer – StoriesTransferaktivitäten und Forschung konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil! Das ist ein Kernergebnis der Studie „Transfer 1000“ von TU Berlin und…→„Transfer 1000“: Studie zum Wissenschaftstransfer
-
Insights Transfer – Stories
 © edelviz
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→
© edelviz
Insights Transfer – StoriesBrain City Interview mit Lia Carlucci, Geschäftsführin des Food Campus Berlin. Sie erzählt mehr über den aktuellen Stand des Projekts – und erläutert,…→„Kollaboration statt Wettbewerb“
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © HTW/ZfS
Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→
© HTW/ZfS
Facts & Events Transfer – StoriesKlima, Gesundheit und Nachhaltigkeit – das sind die Kernthemen der Transferale. Vom 25. bis zum 27. September findet das Wissenschafts- und…→Ideen für Berlins Zukunft
-
Insights
 © Shutterstock / Andrii Yalanskyi
InsightsWissenschaft alltagsnah und allgemeinverständlich zu vermitteln – das ist der Ansatz von Prof. Dr. Sascha Friesike. Der Brain City Botschafter ist…→
© Shutterstock / Andrii Yalanskyi
InsightsWissenschaft alltagsnah und allgemeinverständlich zu vermitteln – das ist der Ansatz von Prof. Dr. Sascha Friesike. Der Brain City Botschafter ist…→„Wissenschaft muss selbst erklären können, was sie tut“
-
Startup Transfer – Stories
 © STOFF2/Kerstin Reisch
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up STOFF2 will die „Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse“ (ZZE) zur Marktreife bringen und arbeitet dabei auch eng mit der Technischen…→
© STOFF2/Kerstin Reisch
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up STOFF2 will die „Zink-Zwischenschritt-Elektrolyse“ (ZZE) zur Marktreife bringen und arbeitet dabei auch eng mit der Technischen…→Der kleine, feine Zwischenschritt
-
Insights Transfer – Stories
 © WISTA Management GmbH – www.adlershof.de
Insights Transfer – StoriesDer Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist der größte der insgesamt elf Berliner Zukunftsorte. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und…→
© WISTA Management GmbH – www.adlershof.de
Insights Transfer – StoriesDer Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist der größte der insgesamt elf Berliner Zukunftsorte. Die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und…→„Wir leben von der Nähe und dem Austausch“
-
Insights
 © Neurospace
InsightsDas Start-up Neurospace, steht wie kein anderes für die boomende „New Space“-Industrie in der Brain City Berlin. Im Interview: Irene Selvanathan,…→
© Neurospace
InsightsDas Start-up Neurospace, steht wie kein anderes für die boomende „New Space“-Industrie in der Brain City Berlin. Im Interview: Irene Selvanathan,…→„Wir wollen Wissenschaft und Industrie zum Mond bringen“
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin Partner
Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→
© Berlin Partner
Insights Transfer – StoriesDas Cluster „Additive Manufacturing Berlin Brandenburg“ will den Transfer von Ergebnissen aus der Spitzenforschung in international wettbewerbsfähige…→AMBER: Vernetzung von Spitzenforschung und Industrie
-
Insights Transfer – Stories
 © Kai Müller Photography
Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→
© Kai Müller Photography
Insights Transfer – StoriesEin Zeitungsinterview gab den Anstoß zur Gründung des Start-ups. Mehr erzählt airpuls-Gründer Prof. Dr.-Ing. habil. Slawomir Stanczak im Brain…→airpuls: 5-G-Lösungen aus der Forschung
-
Insights Transfer – Stories
 Shutterstock © optimarc
Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→
Shutterstock © optimarc
Insights Transfer – StoriesMit einem neuen Transferzertifikat bescheinigt die TU Berlin Studierenden, die sich mit Methoden und Fragestellungen des Wissens- und…→Blick über den Tellerrand hinaus
-
Insights Transfer – Stories Innovationen
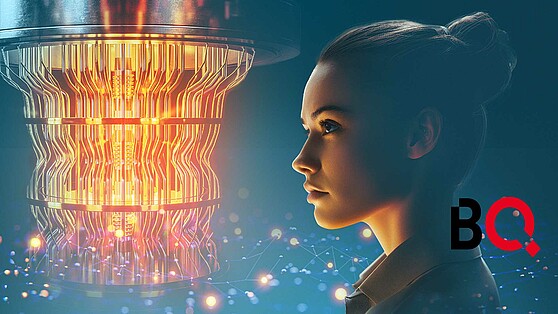 © Berlin Partner
Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→
© Berlin Partner
Insights Transfer – Stories InnovationenQuantentechnologie gilt als der nächste große Technologiesprung. Die Brain City Berlin bietet dafür ideale Voraussetzungen.→BERLIN QUANTUM: neue Initiative für Quantentechnologien
-
Insights Transfer – Stories
 Design © Sarah Engler; Foto © Alexander Bob
Insights Transfer – StoriesBrain City-Interview mit Prof. Dr. Uwe Bettig. Als Professor für Management und Betriebswirtschaft an der ASH Berlin leitet er das IFAF-Projekt…→
Design © Sarah Engler; Foto © Alexander Bob
Insights Transfer – StoriesBrain City-Interview mit Prof. Dr. Uwe Bettig. Als Professor für Management und Betriebswirtschaft an der ASH Berlin leitet er das IFAF-Projekt…→Viele kreative Ideen und Ansätze
-
Insights Transfer – Stories
 © Ivar Veermae
Insights Transfer – StoriesAm Coworking Space EINS in Berlin-Charlottenburg fördert die TU Berlin Start-ups, die den globalen Herausforderungen gleich dreifach nachhaltig…→
© Ivar Veermae
Insights Transfer – StoriesAm Coworking Space EINS in Berlin-Charlottenburg fördert die TU Berlin Start-ups, die den globalen Herausforderungen gleich dreifach nachhaltig…→Ökonomisch, ökologisch, sozial
-
Facts & Events Transfer – Stories
 TU Berlin © Felix Noak
Facts & Events Transfer – StoriesNoch bis zum 29. April können interdisziplinäre Forschungsteams Proposals für die Next Grand Challenge der Berlin University Alliance einreichen.→
TU Berlin © Felix Noak
Facts & Events Transfer – StoriesNoch bis zum 29. April können interdisziplinäre Forschungsteams Proposals für die Next Grand Challenge der Berlin University Alliance einreichen.→Next Grand Challenge: jetzt bewerben!
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Alfred-Wegener-Institut/Micheal Gutsche (CC-BY 4.0)
Facts & Events Transfer – StoriesEine Sonderausstellung im Deutschen Technikmuseum macht eiswürfelklar: Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Arktis zu retten.→
© Alfred-Wegener-Institut/Micheal Gutsche (CC-BY 4.0)
Facts & Events Transfer – StoriesEine Sonderausstellung im Deutschen Technikmuseum macht eiswürfelklar: Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Arktis zu retten.→Ausstellungstipp: „Dünnes Eis“
-
Insights Transfer – Stories
 © Zukunftsorte Berlin
Insights Transfer – StoriesInterview mit Brain City Botschafter Steffen Terberl, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsorte.→
© Zukunftsorte Berlin
Insights Transfer – StoriesInterview mit Brain City Botschafter Steffen Terberl, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsorte.→„Damit in Berlin wieder Innovationsgeschichte geschrieben werden kann“
-
Insights Transfer – Stories
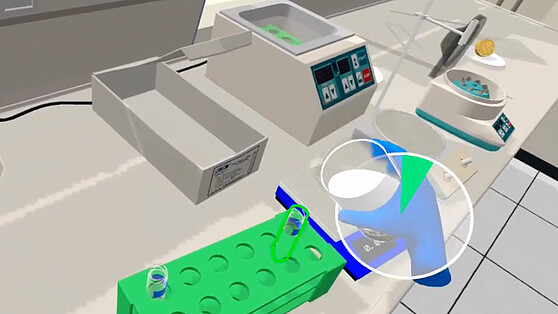 © BHT-MINT-VR-Labs
Insights Transfer – StoriesIn den MINT-VR-Labs an der Berliner Hochschule für Technik arbeitet ein interdisziplinäres Team an didaktischen Konzepten für virtuelle Labore und…→
© BHT-MINT-VR-Labs
Insights Transfer – StoriesIn den MINT-VR-Labs an der Berliner Hochschule für Technik arbeitet ein interdisziplinäres Team an didaktischen Konzepten für virtuelle Labore und…→Spielerisch lernen im virtuellen Biolabor
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © BPWT
Facts & Events Transfer – StoriesMit einer ganztägigen Auftaktkonferenz in den stilwerk KantGaragen geht die Transfer Week Berlin-Brandenburg 2023 an den Start.→
© BPWT
Facts & Events Transfer – StoriesMit einer ganztägigen Auftaktkonferenz in den stilwerk KantGaragen geht die Transfer Week Berlin-Brandenburg 2023 an den Start.→„Wissenschaft x Wirtschaft“: Transfer Week 2023
-
Insights Transfer – Stories
 © edelVIZ
Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→
© edelVIZ
Insights Transfer – StoriesAb 2024 soll im Berliner Industriegebiet Tempelhof-Ost der Food Campus Berlin entstehen. Ein Science Park mit den Schwerpunkten Ernährung und…→Think Tank für die Ernährung der Zukunft
-
Insights Transfer – Stories
 © Berlin Partner/Wüstenhagen
Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→
© Berlin Partner/Wüstenhagen
Insights Transfer – StoriesIm Mittelpunkt stehen der Wissenschaftsstandort, der für Berlin charakteristische Wissenschafts- und Technologietransfer – und natürlich die Brain…→Brain City Berlin launcht neue Kampagnenmotive
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→
© Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist wieder Berlin Science Week. Neu in diesem Jahr: Das ART & SCIENCE FORUM im Holzmarkt 25 ist neben dem CAMPUS im…→Mit Fokus auf Kunst & Wissenschaft: Berlin Science Week 2023
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Facts & Events Transfer – StoriesDie Brain City Berlin hat ein neues Gründerzentrum: Der BerlinBioCube auf dem Campus Berlin-Buch umfasst 8.000 Quadratmeter moderne Labor- und…→
© Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Facts & Events Transfer – StoriesDie Brain City Berlin hat ein neues Gründerzentrum: Der BerlinBioCube auf dem Campus Berlin-Buch umfasst 8.000 Quadratmeter moderne Labor- und…→BerlinBioCube eröffnet
-
Insights Transfer – Stories
 © Gisma
Insights Transfer – StoriesSeit 2017 sitzt die Gisma University of Applied Sciences mit einem Campus in der Brain City Berlin. Mehr als 660 Studierende aus aller Welt werden an…→
© Gisma
Insights Transfer – StoriesSeit 2017 sitzt die Gisma University of Applied Sciences mit einem Campus in der Brain City Berlin. Mehr als 660 Studierende aus aller Welt werden an…→Praxisorientiert studieren und der Wirtschaft Impulse geben
-
Facts & Events Transfer – Stories
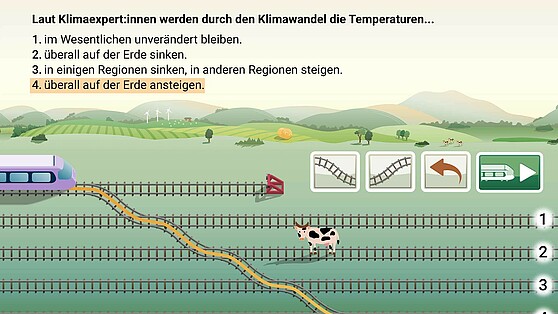 © HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDie App „TRAIN 4 Science“ regt Kinder, aber auch Erwachsene spielerisch dazu an, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Konzipiert und…→
© HU Berlin
Facts & Events Transfer – StoriesDie App „TRAIN 4 Science“ regt Kinder, aber auch Erwachsene spielerisch dazu an, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Konzipiert und…→Mit dem virtuellen Zug in eine nachhaltige Zukunft
-
Insights Transfer – Stories
 © HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesAm Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Schöneweide trifft Tradition auf Ideen und Lösungen von morgen. Der wissenschaftliche Nucleus des…→
© HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesAm Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Schöneweide trifft Tradition auf Ideen und Lösungen von morgen. Der wissenschaftliche Nucleus des…→Ort der Innovation und Transformation
-
Insights Transfer – Stories
 © vdo
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Claus Bull und Dipl.-Ing. Dirk Jäger untersuchen an der Berliner Hochschule für Technik, was Straßenbäume zum Überleben brauchen und wie sie…→
© vdo
Insights Transfer – StoriesProf. Dr. Claus Bull und Dipl.-Ing. Dirk Jäger untersuchen an der Berliner Hochschule für Technik, was Straßenbäume zum Überleben brauchen und wie sie…→„Wir muten den Bäumen in der Stadt ganz schön viel zu“
-
Insights Transfer – Stories
 © LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan
Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→
© LAS Art Foundation/Juan Camilo Roan
Insights Transfer – Stories„Pollinator Pathmaker“ heißt das lebendige Kunstwerk der britischen Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Museum für Naturkunde Berlin. Ihr…→Garten-Kunst aus der Insektenperspektive
-
Insights Transfer – Stories
 © HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDas Projekt „Zukunft findet Stadt – Hochschulnetzwerk für ein resilientes Berlin“ ist für Berlin bisher einzigartig. Mehr erzählt Projektleiterin…→
© HTW Berlin/Alexander Rentsch
Insights Transfer – StoriesDas Projekt „Zukunft findet Stadt – Hochschulnetzwerk für ein resilientes Berlin“ ist für Berlin bisher einzigartig. Mehr erzählt Projektleiterin…→„Wir wollen, dass Innovationen, die in Berlin entstehen, hier auch umgesetzt werden“
-
Facts & Events Transfer – Stories
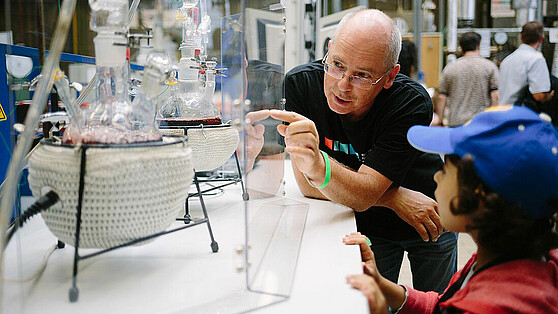 © BHT/Zarko Martovic
Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→
© BHT/Zarko Martovic
Facts & Events Transfer – StoriesAm 17. Juni ist es wieder so weit: Mehr als 60 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der Brain City Berlin und Potsdam öffnen ihre…→Lange Nacht der Wissenschaften 2023
-
Facts & Events Transfer – Stories
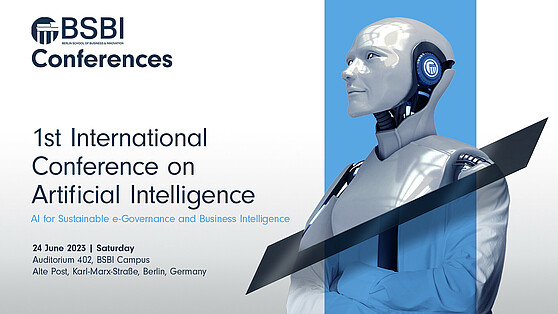 © BSBI
Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→
© BSBI
Facts & Events Transfer – StoriesAm 24. Juni trifft sich die KI-Szene in Berlin-Neukölln. Auf der „1. Internationalen Konferenz für Künstliche Intelligenz“ an der BSBI geht es vor…→KI-Konferenz an der Berlin School of Business & Innovation
-
Startup Transfer – Stories
 © Quantistry
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up Quantistry ermöglicht chemische Experimente im digitalen Raum mithilfe Künstlicher Intelligenz und quantenchemischer…→
© Quantistry
Startup Transfer – StoriesDas Berliner Start-up Quantistry ermöglicht chemische Experimente im digitalen Raum mithilfe Künstlicher Intelligenz und quantenchemischer…→Das Chemielabor in der Wolke
-
Insights Transfer – Stories
 © Hallbauer & Fioretti
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, Nobelpreisträgerin und geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die…→
© Hallbauer & Fioretti
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, Nobelpreisträgerin und geschäftsführende Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die…→„Grundlagenforschung ist die Basis für Innovationen“
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © BVG/Andreas Süß
Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→
© BVG/Andreas Süß
Facts & Events Transfer – StoriesWie klingt eigentlich ein E-Bus? Der UdK-Student Lukas Esser hat im Rahmen eines Wettbewerbs den neuen Sound für deutsche E-Busse entwickelt.→Elektro-Sound der Zukunft
-
Insights Transfer – Stories
 © ASH Berlin/Cristián Pérez
Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→
© ASH Berlin/Cristián Pérez
Insights Transfer – StoriesSAGE – das steht für Soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Mehr über das Bündnis zwischen ASH Berlin, KHSB und EHB erzählt Prof. Dr.…→SAGE – ein soziales Dreier-Bündnis
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Maschinenraum
Facts & Events Transfer – StoriesÜber die Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Mittelstandsnetzwerk will die Hochschule für Technik und Wirtschaft weiteres Transferpotenzial…→
© Maschinenraum
Facts & Events Transfer – StoriesÜber die Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Mittelstandsnetzwerk will die Hochschule für Technik und Wirtschaft weiteres Transferpotenzial…→HTW Berlin kooperiert mit Maschinenraum
-
Insights Transfer – Stories
 © QAH
Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→
© QAH
Insights Transfer – StoriesDer Zukunftsort Technologie-Park Humboldthain in Wedding steht für Berliner Industriegeschichte – und für Synergien zwischen Wissenschaft und…→Tradition meets Innovation
-
Insights Transfer – Stories
 © Stefan Schostok
Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→
© Stefan Schostok
Insights Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Selin Arikoglu, Professorin für Kinder und Jugendhilfe an der Katholischen Hochschule für…→Angehörigen von Strafgefangenen eine wissenschaftliche Stimme verleihen
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesMit einem neuen Imagefilm startet Brain City Berlin ins Jahr 2023. Protagonistinnen und Protagonisten des Videos sind unsere Brain…→
© Berlin Partner
Facts & Events Transfer – StoriesMit einem neuen Imagefilm startet Brain City Berlin ins Jahr 2023. Protagonistinnen und Protagonisten des Videos sind unsere Brain…→„Wir sind Brain City Berlin“
-
Insights Transfer – Stories
 © HWR Berlin/Franziska Ihle
Insights Transfer – StoriesIm Projekt „KlinKe“ erforschen Prof. Dr. Silke Bustamante und Prof. Dr. Andrea Pelzeter an der HWR Berlin, welche Sekundärprozesse im Krankenhaus…→
© HWR Berlin/Franziska Ihle
Insights Transfer – StoriesIm Projekt „KlinKe“ erforschen Prof. Dr. Silke Bustamante und Prof. Dr. Andrea Pelzeter an der HWR Berlin, welche Sekundärprozesse im Krankenhaus…→Auf dem Weg zum klimaneutralen Krankenhaus
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Transfer Week
Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→
© Transfer Week
Facts & Events Transfer – StoriesVom 21. bis zum 25. November können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder zusammen mit Unternehmen aus Berlin und Brandenburg…→Impulse setzen für Kooperationen: Transfer Week 2022
-
Facts & Events Transfer – Stories
 © Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→
© Falling Walls Foundation
Facts & Events Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November ist die Brain City Berlin wieder ein Hotspot der internationalen→
Science Community. Interview mit Festival-Leiterin…Wissenschaft für den Dialog mit der Gesellschaft öffnen
-
Insights Transfer – Stories
 Shutterstock © Monster Ztudio
Insights Transfer – StoriesMithilfe von Künstlicher Intelligenz will das in der Brain City Berlin verankerte, interdisziplinäre Forschungsprojekt manipulierte Medien-Inhalte…→
Shutterstock © Monster Ztudio
Insights Transfer – StoriesMithilfe von Künstlicher Intelligenz will das in der Brain City Berlin verankerte, interdisziplinäre Forschungsprojekt manipulierte Medien-Inhalte…→„news-polygraph“: Förderung durch BMBF
-
Insights Transfer – Stories
 © Felix Noak
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Dr. phil. Thorsten Philipp, Referent für Transdisziplinäre Lehre im Präsidium der Technischen Universität Berlin.→
© Felix Noak
Insights Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Dr. phil. Thorsten Philipp, Referent für Transdisziplinäre Lehre im Präsidium der Technischen Universität Berlin.→„Jeder weiß etwas“
-
Insights Transfer – Stories
 @ Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→
@ Ernestine von der Osten-Sacken
Insights Transfer – StoriesHören wie die Fledermaus: Auf "Sound Walk" mit Hannes Hoelzl, Klangkünstler und Dozent für Generative Arts/Computational Arts an der UdK Berlin.→Mit den Ohren sehen
-
Insights
 Foto: privat
InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→
Foto: privat
InsightsEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Prof. Dr. Rainer Zeichhardt, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der BSP – Business & Law…→New Work – neue Arbeitskonzepte für zukunftsfähige Unternehmenskulturen
-
Transfer – Stories
 Foto: Shutterstock © Yurchanka Siarhei
Transfer – Stories22 Millionen Euro wird das Berliner KI-Kompetenzzentrum BIFOLD künftig jährlich vom Bund und dem Land Berlin erhalten.→
Foto: Shutterstock © Yurchanka Siarhei
Transfer – Stories22 Millionen Euro wird das Berliner KI-Kompetenzzentrum BIFOLD künftig jährlich vom Bund und dem Land Berlin erhalten.→Millionenförderung für Berliner KI-Forschung
-
Transfer – Stories
 Falling Walls Foundation © Judith Schalansky
Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November trifft sich die Welt der Wissenschaft wieder in der Brain City Berlin. Organisationen können sich noch bis zum 31. Juli…→
Falling Walls Foundation © Judith Schalansky
Transfer – StoriesVom 1. bis zum 10. November trifft sich die Welt der Wissenschaft wieder in der Brain City Berlin. Organisationen können sich noch bis zum 31. Juli…→„Trau dich, zu wissen“: Berlin Science Week 2022
-
Transfer – Stories
 EUREF AG©Gasometertour.de
Transfer – StoriesAuf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft an klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Lösungen für…→
EUREF AG©Gasometertour.de
Transfer – StoriesAuf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft an klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Lösungen für…→Energiewende zum Anfassen
-
Transfer – Stories
 © SCC Events/Norbert Wilhelmi
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Gabriele Mielke, Vizepräsidentin der VICTORIA | Internationale Hochschule und zugleich…→
© SCC Events/Norbert Wilhelmi
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Gabriele Mielke, Vizepräsidentin der VICTORIA | Internationale Hochschule und zugleich…→„Großveranstaltungen betreffen das Leben der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen“
-
Insights
 Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)
InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→
Dr. Anja Sommerfeld (privat)/ Dr. Gregor Hofmann (David Ausserhofer)
InsightsBrain City-Interview mit Dr. Anja Sommerfeld und Dr. Gregor Hofmann von Berlin Research 50. Die Initiative der Berliner außeruniversitären…→Das Beste aus der Wissenschaftsmetropole Berlin herausholen
-
Transfer – Stories
 Foto: Ernestine von der Osten-Sacken (vdo)
Transfer – StoriesIm Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC sitzen rund 50 Start-ups. Die Vernetzung am Standort ist ausgesprochen gut, denn das CHIC gehört zu einem…→
Foto: Ernestine von der Osten-Sacken (vdo)
Transfer – StoriesIm Charlottenburger Innovations-Centrum CHIC sitzen rund 50 Start-ups. Die Vernetzung am Standort ist ausgesprochen gut, denn das CHIC gehört zu einem…→CHIC – Gründungszentrum am Zukunftsort
-
Transfer – Stories
 Foto: Mall Anders/Matthew Crabbe
Transfer – Stories„Mall Anders“ heißt ein offenes Lernlabor, das FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und Charité – Universitätsmedizin gemeinsam in einer Shopping Mall…→
Foto: Mall Anders/Matthew Crabbe
Transfer – Stories„Mall Anders“ heißt ein offenes Lernlabor, das FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin und Charité – Universitätsmedizin gemeinsam in einer Shopping Mall…→Wissenschaft in der Shopping Mall
-
Transfer – Stories
 BHT/Marti Gasch
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Ivo Boblan, Professor am Studiengang Humanoide Robotik der Berliner Hochschule für Technik, erforscht…→
BHT/Marti Gasch
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Ivo Boblan, Professor am Studiengang Humanoide Robotik der Berliner Hochschule für Technik, erforscht…→„Roboter können uns ganz viel abnehmen“
-
Transfer – Stories
 (V.li.n.re.) Prof. Christian Matzdorf, Polizeikommissar Turgay Akkaya, Stefan Graf Finck von Finckenstein, Foto: HWR Berlin / Sylke Schumann
Transfer – StoriesPolizeikommissar Turgay Akkaya hat im Rahmen seines Bachelor-Projekts an der HWR Berlin eine Anti-Stalking-App entwickelt. Für den hohen Praxisbezug…→
(V.li.n.re.) Prof. Christian Matzdorf, Polizeikommissar Turgay Akkaya, Stefan Graf Finck von Finckenstein, Foto: HWR Berlin / Sylke Schumann
Transfer – StoriesPolizeikommissar Turgay Akkaya hat im Rahmen seines Bachelor-Projekts an der HWR Berlin eine Anti-Stalking-App entwickelt. Für den hohen Praxisbezug…→Eine präventive App gegen Stalking
-
Transfer – Stories
 (V.li.n.re.) Steffen Terberl/FU Berlin; Prof. Dr. Hannes Rothe/ICN Business School, Foto: Ernestine von der Osten-Sacken
Transfer – StoriesIm Bereich BioTech verschenkt die Brain City Berlin Innovations-Potenzial. Zu diesem Schluss kommt der „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und…→
(V.li.n.re.) Steffen Terberl/FU Berlin; Prof. Dr. Hannes Rothe/ICN Business School, Foto: Ernestine von der Osten-Sacken
Transfer – StoriesIm Bereich BioTech verschenkt die Brain City Berlin Innovations-Potenzial. Zu diesem Schluss kommt der „Deep Tech Futures Report 2021: Bio- und…→„BioTech ist kein Selbstläufer“
-
Transfer – Stories
 Foto: Christina Lüdtke privat
Transfer – StoriesVier Universitäten, ein Verbund: Das Netzwerk „Science & Startups“ bündelt die Gründungs-Services der in der Berlin University Alliance vereinten…→
Foto: Christina Lüdtke privat
Transfer – StoriesVier Universitäten, ein Verbund: Das Netzwerk „Science & Startups“ bündelt die Gründungs-Services der in der Berlin University Alliance vereinten…→Breite Unterstützung für Hochschul-Start-ups
-
Transfer – Stories
 Transfer – StoriesVom 22. bis zum 26. November geht es auf der Transfer Week 2021 in digitalen Sessions darum, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu…→
Transfer – StoriesVom 22. bis zum 26. November geht es auf der Transfer Week 2021 in digitalen Sessions darum, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu…→Sensibilisierung für Wissens- und Technologietransfer: Transfer Week 2021
-
Transfer – Stories
 Foto: privat
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Dr. Anna Klippstein, Professorin für Finanzen, und Eliyahu Mätzschker, Student am Touro College Berlin.→
Foto: privat
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Dr. Anna Klippstein, Professorin für Finanzen, und Eliyahu Mätzschker, Student am Touro College Berlin.→Der Einfluss der Pandemie auf den Kapitalmarkt
-
Transfer – Stories
 Foto: André Bakker
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg, Professorin für Internationale BWL an der SRH Berlin University of…→
Foto: André Bakker
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafterin Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg, Professorin für Internationale BWL an der SRH Berlin University of…→Zugang zur Digitalität finden
-
Transfer – Stories
 Swen Hutter (Foto: David Ausserhofer), Gesine Höltmann (Foto: Martina Sander)
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Gesine Höltmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung und und Swen Hutter, stellvertretender…→
Swen Hutter (Foto: David Ausserhofer), Gesine Höltmann (Foto: Martina Sander)
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Gesine Höltmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung und und Swen Hutter, stellvertretender…→Polarisierung und Zusammenhalt in der Corona-Krise
-
Transfer – Stories
 Foto: "Lucid Dream", Elena Kunau und Mariya Yordanova
Transfer – StoriesARTIFICIAL REALITY – VIRTUAL INTELLIGENCE heißt die Ausstellung, die vom 8. bis 12. September im Rahmen des Ars Electronica Garden Berlin zu sehen…→
Foto: "Lucid Dream", Elena Kunau und Mariya Yordanova
Transfer – StoriesARTIFICIAL REALITY – VIRTUAL INTELLIGENCE heißt die Ausstellung, die vom 8. bis 12. September im Rahmen des Ars Electronica Garden Berlin zu sehen…→Interaktion durch Emotion
-
Transfer – Stories
 Foto: Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Transfer – StoriesDer Campus Berlin-Buch im Norden der Brain City Berlin entwickelt sich zu einem der größten Wirtschafts- und Forschungsstandorte für Life Sciences in…→
Foto: Peter Himsel/Campus Berlin-Buch GmbH
Transfer – StoriesDer Campus Berlin-Buch im Norden der Brain City Berlin entwickelt sich zu einem der größten Wirtschafts- und Forschungsstandorte für Life Sciences in…→Lebendiges Gesundheitsnetzwerk
-
Transfer – Stories
 Credit: Markus Krutzik
Transfer – StoriesDr. Markus Krutzik, Leiter des Joint Lab Integrated Quantum Sensors (IQS), über die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ von der…→
Credit: Markus Krutzik
Transfer – StoriesDr. Markus Krutzik, Leiter des Joint Lab Integrated Quantum Sensors (IQS), über die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ von der…→„Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die in der Quantensensorik schlummern“
-
Transfer – Stories
 Foto: ESCP Business School Berlin
Transfer – StoriesWas tun, wenn in der Lehre auf einmal Distanz verordnet ist? Ein Gastbeitrag von Dr. René Mauer, Professor für Entrepreneurship und Innovation an der…→
Foto: ESCP Business School Berlin
Transfer – StoriesWas tun, wenn in der Lehre auf einmal Distanz verordnet ist? Ein Gastbeitrag von Dr. René Mauer, Professor für Entrepreneurship und Innovation an der…→Mit Whiteboards gegen die digitale Müdigkeit
-
Transfer – Stories
 Credit: Alexander Rentsch/HTW Berlin
Transfer – StoriesProf. Dr. Florian Koch bringt als Experte für Stadtentwicklung und Smart Cities an der HTW Berlin in seiner Forschung Wissenschaft, Wirtschaft und…→
Credit: Alexander Rentsch/HTW Berlin
Transfer – StoriesProf. Dr. Florian Koch bringt als Experte für Stadtentwicklung und Smart Cities an der HTW Berlin in seiner Forschung Wissenschaft, Wirtschaft und…→„Die zunehmende Urbanisierung bietet auch Chancen“
-
Transfer – Stories
 Foto: Hannah Kerkhoff
Transfer – StoriesProf. Dr. Johannes Gräske, Leiter des Studiengangs Pflege an der ASH Berlin, im Brain City-Interview.→
Foto: Hannah Kerkhoff
Transfer – StoriesProf. Dr. Johannes Gräske, Leiter des Studiengangs Pflege an der ASH Berlin, im Brain City-Interview.→Mit Akademisierung dem Pflexit begegnen
-
Transfer – Stories
 Credit: Rudolf Grillborzer
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Onur Günlü, Nachwuchsgruppenleiter und Dozent am Lehrstuhl für Informationstheorie und deren…→
Credit: Rudolf Grillborzer
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain City-Botschafter Dr.-Ing. Onur Günlü, Nachwuchsgruppenleiter und Dozent am Lehrstuhl für Informationstheorie und deren…→Ausloten der „ultimativen Grenze“
-
Transfer – Stories
 Credt: Startup Incubator Berlin
Transfer – StoriesDer Startup Incubator Berlin (SIB) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin bringt Gründer-Teams besonders erfolgreich an den Start – wie die…→
Credt: Startup Incubator Berlin
Transfer – StoriesDer Startup Incubator Berlin (SIB) der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin bringt Gründer-Teams besonders erfolgreich an den Start – wie die…→„Wir bringen Ideen an den Markt“
-
Transfer – Stories
 Credit: Mimi Thian on Unsolash
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain-City-Botschafter Dr. Petyo Budakov, University of Europe for Applied Sciences.→
Credit: Mimi Thian on Unsolash
Transfer – StoriesEin Gastbeitrag von Brain-City-Botschafter Dr. Petyo Budakov, University of Europe for Applied Sciences.→„Mit Stolz präsentiert: die Brain City Berlin 2020“
-
Transfer – Stories
 Susanne Plaumann (privat)
Transfer – StoriesEin Interview mit Brain City-Botschafterin Susanne Plaumann M.A., Zentrale Frauenbeauftragte an der Beuth Hochschule für Technik Berlin, anlässlich…→
Susanne Plaumann (privat)
Transfer – StoriesEin Interview mit Brain City-Botschafterin Susanne Plaumann M.A., Zentrale Frauenbeauftragte an der Beuth Hochschule für Technik Berlin, anlässlich…→„Karrieren sind für Wissenschaftlerinnen heute planbarer“
-
Transfer – Stories
 Adi Goldstein auf Unsplash
Transfer – StoriesDie StadtManufaktur Berlin vereint Forschungsprojekte der TU Berlin unter einem Dach. Langfristiges Ziel dieser „offenen Laborsituation“: die Brain…→
Adi Goldstein auf Unsplash
Transfer – StoriesDie StadtManufaktur Berlin vereint Forschungsprojekte der TU Berlin unter einem Dach. Langfristiges Ziel dieser „offenen Laborsituation“: die Brain…→Wissenschaft im Austausch mit der Stadt
-
Transfer – Stories
 Falk Weiß
Transfer – StoriesDas Wissensportal „humboldts17“ stellt aktuelle Forschung rund um das Thema Nachhaltigkeit vor und lädt zu einem Austausch mit der breiten…→
Falk Weiß
Transfer – StoriesDas Wissensportal „humboldts17“ stellt aktuelle Forschung rund um das Thema Nachhaltigkeit vor und lädt zu einem Austausch mit der breiten…→17 Ziele für die Zukunft
-
Transfer – Stories
 Foto: Olga Makarova privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Dr. Olga Makarova über ihre Forschung während der Pandemie – und den Bedarf der Gesellschaft an mikrobiologischem Wissen.→
Foto: Olga Makarova privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Dr. Olga Makarova über ihre Forschung während der Pandemie – und den Bedarf der Gesellschaft an mikrobiologischem Wissen.→Gastbeitrag: COVID-19 und mikrobiologisches Wissen
-
Transfer – Stories
 HIIG
Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Forschungsdirektor im Bereich „Internet und Medienregulierung“ am Alexander von Humboldt Institut…→
HIIG
Transfer – StoriesIm Brain City-Interview: Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Forschungsdirektor im Bereich „Internet und Medienregulierung“ am Alexander von Humboldt Institut…→„Ein nachhaltiges Ziel unserer Arbeit ist es, zu verdeutlichen, was die Technik eigentlich kann“
-
Transfer – Stories
 HTW Berlin
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafter Prof. Dr. Kai Reinhardt. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Gast beim 2. SpreeTalk der HTW Berlin am 29. 10.…→
HTW Berlin
Transfer – StoriesInterview mit Brain City-Botschafter Prof. Dr. Kai Reinhardt. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Gast beim 2. SpreeTalk der HTW Berlin am 29. 10.…→„Die Corona-Krise wirkt als Katalysator der Digitalisierung“
-
Transfer – Stories
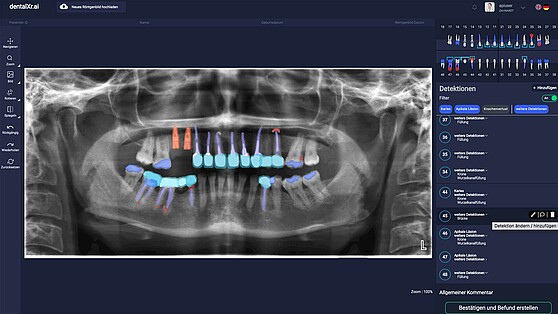 dentalXr.ai
Transfer – StoriesdentalXrai ist das erste zahnmedizinische Start-up, das sich aus der Charité heraus gegründet hat. Auf den Weg gebracht wurde es über den Accelerator…→
dentalXr.ai
Transfer – StoriesdentalXrai ist das erste zahnmedizinische Start-up, das sich aus der Charité heraus gegründet hat. Auf den Weg gebracht wurde es über den Accelerator…→Mit künstlicher Intelligenz gegen Karies & Co.
-
Transfer – Stories
 Anna Raysyan privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Anna Raysyan lebt seit 3,5 Jahren in Berlin. Sie ist Doktorandin an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung…→
Anna Raysyan privat
Transfer – StoriesBrain City-Botschafterin Anna Raysyan lebt seit 3,5 Jahren in Berlin. Sie ist Doktorandin an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung…→Gastbeitrag: „Berlin mag die Mutigen!"
-
Transfer – Stories
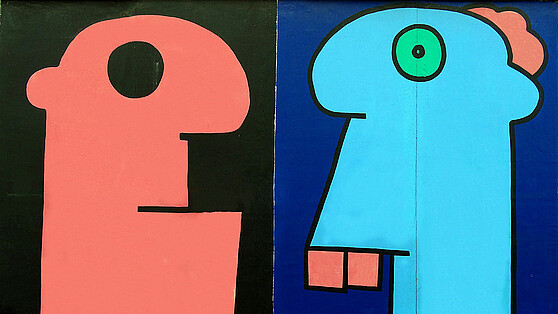 ©Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
Transfer – StoriesViele hochkarätige Wissenschaftler*innen zieht es jährlich in die Brain City Berlin. Das Dual Career Network Berlin unterstützt Partner*innen von…→
©Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie
Transfer – StoriesViele hochkarätige Wissenschaftler*innen zieht es jährlich in die Brain City Berlin. Das Dual Career Network Berlin unterstützt Partner*innen von…→Dual Career Network Berlin – Fuß fassen in Berlin
-
Transfer – Stories
 ©Matthias Picket
Transfer – StoriesDr. Anne Schreiter, Geschäftsführerin der German Scholars Organization (GSO), verrät im Brain City-Interview, welche alternativen…→
©Matthias Picket
Transfer – StoriesDr. Anne Schreiter, Geschäftsführerin der German Scholars Organization (GSO), verrät im Brain City-Interview, welche alternativen…→„Wissenschaft bedeutet nicht nur Forschung“
-
Transfer – Stories
 © Pocky Lee on Unsplash
Transfer – StoriesGeisterspiele vor leeren Rängen, virtuelle Marathons und Eventverschiebungen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spitzen- und Breitensport…→
© Pocky Lee on Unsplash
Transfer – StoriesGeisterspiele vor leeren Rängen, virtuelle Marathons und Eventverschiebungen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spitzen- und Breitensport…→„Jetzt schlägt die Stunde der Innovator*innen“
-
Transfer – Stories
 © AW Creative on Unsplash
Transfer – StoriesDas Studium oder eine Lehr- bzw. Forschungstätigkeit mit der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen zu vereinbaren, ist keine leichte…→
© AW Creative on Unsplash
Transfer – StoriesDas Studium oder eine Lehr- bzw. Forschungstätigkeit mit der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen zu vereinbaren, ist keine leichte…→Von der Tierparkschule bis zum Mutterschutz – familienfreundliche Hochschulen
-
Transfer – Stories
 © HTW Berlin / Nikolas Fahlbusch
Transfer – StoriesLehre findet momentan ausschließlich online statt. Gastautorin Dr. Dorothee Haffner, Professorin im Studiengang Museumskunde der Hochschule für…→
© HTW Berlin / Nikolas Fahlbusch
Transfer – StoriesLehre findet momentan ausschließlich online statt. Gastautorin Dr. Dorothee Haffner, Professorin im Studiengang Museumskunde der Hochschule für…→Gastbeitrag: „Online-Lehre ist lebhafter, als ich gedacht habe“
-
Transfer – Stories
 Franziska Sattler
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafterin Franziska Sattler über ihre Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch mit Wissenschaft“ im Museum für Naturkunde…→
Franziska Sattler
Transfer – StoriesIm Interview: Brain City-Botschafterin Franziska Sattler über ihre Veranstaltungsreihe „Kaffeeklatsch mit Wissenschaft“ im Museum für Naturkunde…→„Die Wissenschaft braucht das Vertrauen der Gesellschaft“
-
Transfer – Stories
 Fotocredit: Ortner & Ortner / Siemens
Transfer – StoriesSiemensstadt 2.0 ist ein Ort der Zukunft. Bis 2030 soll auf dem historischen Firmengelände im Nordwesten der Brain City ein moderner, weltoffener…→
Fotocredit: Ortner & Ortner / Siemens
Transfer – StoriesSiemensstadt 2.0 ist ein Ort der Zukunft. Bis 2030 soll auf dem historischen Firmengelände im Nordwesten der Brain City ein moderner, weltoffener…→Siemensstadt 2.0: Forschung und Industrie eng verknüpft
-
Transfer – Stories
 ©Credit Silke Oßwald/FMP
Transfer – StoriesProfessor Dr. Volker Haucke, Direktor am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Professor für Molekulare Pharmakologie an…→
©Credit Silke Oßwald/FMP
Transfer – StoriesProfessor Dr. Volker Haucke, Direktor am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und Professor für Molekulare Pharmakologie an…→Im Spagat zwischen Detail und Gesamtkonzept
-
Transfer – Stories
 © hj barraza/Unsplash
Transfer – StoriesUnsere Gastautorin Dr. Barbara Schäuble, Professorin für„Diversitätsbewusste Ansätze in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit“ an der Alice Salomon…→
© hj barraza/Unsplash
Transfer – StoriesUnsere Gastautorin Dr. Barbara Schäuble, Professorin für„Diversitätsbewusste Ansätze in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit“ an der Alice Salomon…→Gastbeitrag: Ein plötzlicher Kurswechsel – Präsenzblöcke ins Netz verlegen
-
Transfer – Stories
 ©DexLeChem
Transfer – StoriesAus der Hochschule heraus ein Start-up gründen? Sonja Jost machte es erfolgreich vor. Gemeinsam mit drei Kommiliton*innen gründete sie nach dem…→
©DexLeChem
Transfer – StoriesAus der Hochschule heraus ein Start-up gründen? Sonja Jost machte es erfolgreich vor. Gemeinsam mit drei Kommiliton*innen gründete sie nach dem…→„Neue Erkenntnisse in den Markt zu bringen, ist uns sehr wichtig“
-
Transfer – Stories
 ©Ivar Veermäe / Centre for Entrepreneurship
Transfer – StoriesUm herauszufinden, welche wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftsbasierte Ausgründungen für Berlin und Brandenburg haben, führen insgesamt zehn…→
©Ivar Veermäe / Centre for Entrepreneurship
Transfer – StoriesUm herauszufinden, welche wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftsbasierte Ausgründungen für Berlin und Brandenburg haben, führen insgesamt zehn…→„Vor allem die Gesellschaft profitiert von Hightech-Start-ups“– Gründungsumfrage der Hochschulen geht in die dritte Runde
-
Transfer – Stories
 ©BIH|Thomas Rafalzyk
Transfer – StoriesAm Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) geht es vor allem um „Translation“: die Übertragung von Erkenntnissen aus dem Forschungslabor in…→
©BIH|Thomas Rafalzyk
Transfer – StoriesAm Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) geht es vor allem um „Translation“: die Übertragung von Erkenntnissen aus dem Forschungslabor in…→„Es gibt es inzwischen viele tolle Wissenschaftlerinnen, die Großartiges leisten“
-
Transfer – Stories
 ©fotografixx-istockphoto.com
Transfer – StoriesDas Lernverhalten im digitalen Zeitalter ändert sich grundlegend. Es stellt die Studierenden in den Mittelpunkt und ist technologieorientiert.→
©fotografixx-istockphoto.com
Transfer – StoriesDas Lernverhalten im digitalen Zeitalter ändert sich grundlegend. Es stellt die Studierenden in den Mittelpunkt und ist technologieorientiert.→Die Zukunft des Lernens erforschen
-
Transfer – Stories
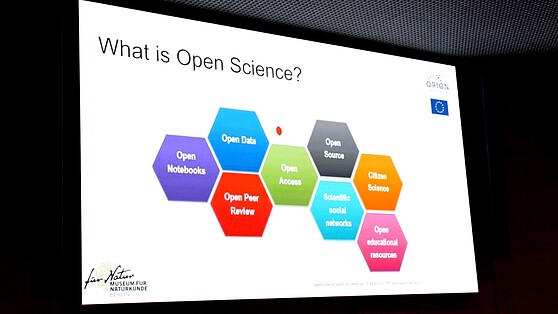 © Brain City Berlin
Transfer – StoriesForschungsergebnisse schnell und einfach zugänglich im Netz: Die Open-Access-Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im Publikationswesen und…→
© Brain City Berlin
Transfer – StoriesForschungsergebnisse schnell und einfach zugänglich im Netz: Die Open-Access-Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im Publikationswesen und…→Open Access: freies Wissen für alle
-
Transfer – Stories
 ©ESCP EUROPE
Transfer – Stories29.10.2019 | Prof. Dr. Andreas Kaplan ist Brain City Berlin-Botschafter und Rektor der ESCP Europe Business School Berlin. In seiner Forschung…→
©ESCP EUROPE
Transfer – Stories29.10.2019 | Prof. Dr. Andreas Kaplan ist Brain City Berlin-Botschafter und Rektor der ESCP Europe Business School Berlin. In seiner Forschung…→„Wir müssen es schaffen, jeden auf die Reise mitzunehmen“
-
Transfer – Stories
 Gudrun Piechotta-Henze
Transfer – StoriesZum Wintersemester 2020/21 führt die Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin den ersten primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Pflege in der Brain…→
Gudrun Piechotta-Henze
Transfer – StoriesZum Wintersemester 2020/21 führt die Alice Salomon Hochschule (ASH) Berlin den ersten primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Pflege in der Brain…→„Wir müssen Pflege völlig neu denken!“ | 27.09.2019
-
Transfer – Stories
 ©Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde
Transfer – StoriesDas Kursangebot der HUWISU Summer University ist vielfältig und spannend, die Zielgruppe international: Studierende aus dem Ausland, die für einige…→
©Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde
Transfer – StoriesDas Kursangebot der HUWISU Summer University ist vielfältig und spannend, die Zielgruppe international: Studierende aus dem Ausland, die für einige…→Wenn Berlin zum Seminarraum wird ... | 15.08.2019
-
Transfer – Stories
 Transfer – StoriesDie Literaturwissenschaftlerin Dr. Betiel Wasihun war wissenschaftlich international unterwegs. Nach Stationen in Heidelberg, Yale und Oxford zog es…→
Transfer – StoriesDie Literaturwissenschaftlerin Dr. Betiel Wasihun war wissenschaftlich international unterwegs. Nach Stationen in Heidelberg, Yale und Oxford zog es…→„Berlin ist ein perfekter Standort. Vor allem, wenn man wissenschaftlich nicht eingleisig fahren möchte“ | 12.08.2019
-
Transfer – Stories
 Berlin University Alliance/Matthias Heyde
Transfer – StoriesGemeinsam ist man stärker. Und auch erfolgreicher. Als „Berlin University Alliance“ bewarben sich die Technische Universität Berlin, die Freie…→
Berlin University Alliance/Matthias Heyde
Transfer – StoriesGemeinsam ist man stärker. Und auch erfolgreicher. Als „Berlin University Alliance“ bewarben sich die Technische Universität Berlin, die Freie…→Herzlichen Glückwunsch: „Berlin University Alliance“ erhält Exzellenzförderung |19.07.2019
-
Transfer – Stories
 David Ausserhofer/IGB
Transfer – StoriesBerlin ist eine der wasserreichsten Städte Deutschlands. Doch auch vor Havel, Spree und Wannsee macht der Klimawandel nicht halt. Am Leibniz-Institut…→
David Ausserhofer/IGB
Transfer – StoriesBerlin ist eine der wasserreichsten Städte Deutschlands. Doch auch vor Havel, Spree und Wannsee macht der Klimawandel nicht halt. Am Leibniz-Institut…→„Wir versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen“ | 04.07.2019
-
Transfer – Stories
 Helena Lopes / Unsplash
Transfer – StoriesEin digitaler Lutscher, zarte Duftnoten per Mail verschicken oder sich den Wind virtuell um die Nase wehen lassen – die Forschung macht’s möglich. Ein…→
Helena Lopes / Unsplash
Transfer – StoriesEin digitaler Lutscher, zarte Duftnoten per Mail verschicken oder sich den Wind virtuell um die Nase wehen lassen – die Forschung macht’s möglich. Ein…→Die Welt mit allen Sinnen digital erleben | 18.06.2019
-
Transfer – Stories
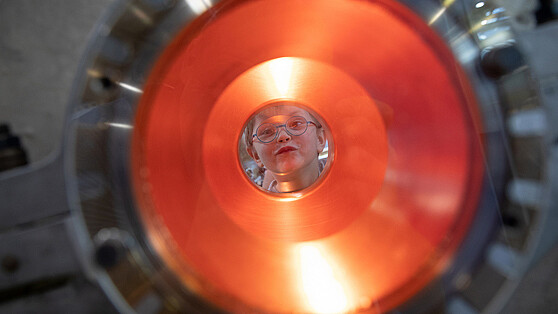 HZB/M. Setzpfandt
Transfer – StoriesIn Zeiten von Fake News und pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen fällt es vielen Menschen schwer, seriöse von unseriösen Inhalten zu…→
HZB/M. Setzpfandt
Transfer – StoriesIn Zeiten von Fake News und pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen fällt es vielen Menschen schwer, seriöse von unseriösen Inhalten zu…→„Wissenschaft muss neugierig machen“ | 11.06.2019
-
Transfer – Stories
 Tim Landgraf
Transfer – StoriesDie Brain City Berlin gilt als einer der führenden Standorte für Künstliche Intelligenz in Deutschland. An zahlreichen Instituten, Universitäten und…→
Tim Landgraf
Transfer – StoriesDie Brain City Berlin gilt als einer der führenden Standorte für Künstliche Intelligenz in Deutschland. An zahlreichen Instituten, Universitäten und…→Von Fischen, Bienen und selbstfahrenden Autos | 07.06.2019
-
Transfer – Stories
 Berlin Partner / Wüstenhagen
Transfer – StoriesWissenschaft und Kulturerbe, jederzeit für jedermann frei zugänglich im Netz: Die Open Access Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im…→
Berlin Partner / Wüstenhagen
Transfer – StoriesWissenschaft und Kulturerbe, jederzeit für jedermann frei zugänglich im Netz: Die Open Access Bewegung wirbt für einen Paradigmenwechsel im…→Wissen für Alle - Open Access in Berlin | 28.03.2019
-
Transfer – Stories
 Thomas Rosenthal - Museum für Naturkunde Berlin
Transfer – Stories660 Millionen Euro in 10 Jahren: Das Museum für Naturkunde Berlin erhält finanzielle Unterstützung für die Weiterentwicklung der Erforschung der…→
Thomas Rosenthal - Museum für Naturkunde Berlin
Transfer – Stories660 Millionen Euro in 10 Jahren: Das Museum für Naturkunde Berlin erhält finanzielle Unterstützung für die Weiterentwicklung der Erforschung der…→Zukunft des Museums für Naturkunde Berlin | 14.01.2019
-
Transfer – Stories
 Transfer – StoriesDass die Raumfahrt eine Revolution in der Kommerzialisierung erfährt, dürfte dank Firmen wie Elon Musks SpaceX bekannt sein. Doch ist auch bekannt,…→
Transfer – StoriesDass die Raumfahrt eine Revolution in der Kommerzialisierung erfährt, dürfte dank Firmen wie Elon Musks SpaceX bekannt sein. Doch ist auch bekannt,…→Von Berlin zum Mond: Die Berliner Raumfahrt-Szene boomt | 03.09.2018