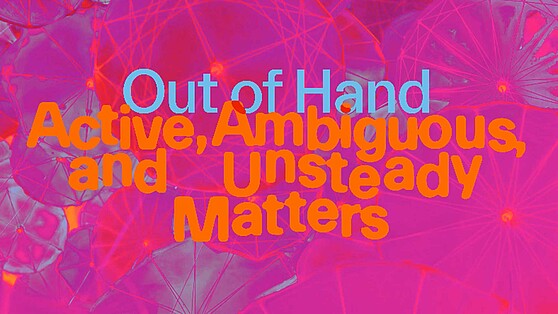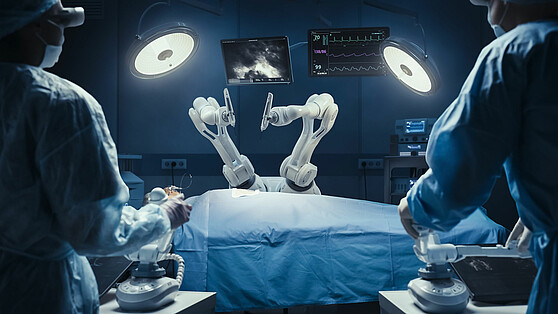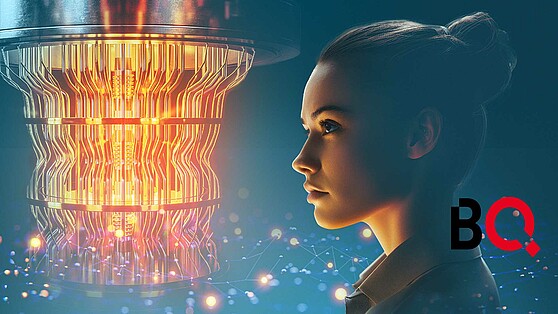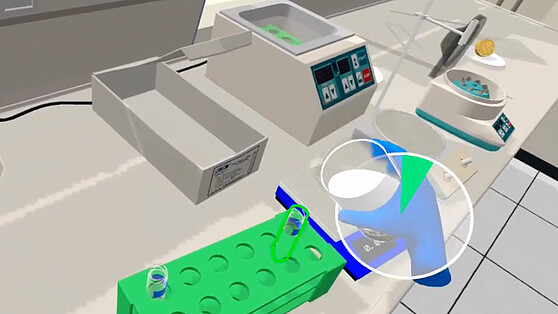-

© Shutterstock / Andrii Yalanskyi
09.09.2024„Wissenschaft muss selbst erklären können, was sie tut“
Wissenschaft alltagsnah und allgemeinverständlich zu vermitteln – das ist der Ansatz von Prof. Dr. Sascha Friesike. Der Brain City Botschafter ist Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und leitet den Studiengang „Leadership in digitaler Innovation" an der Universität der Künste Berlin. Auf dem rbb-YouTube-Kanal „Menschen und Muster“ gibt er kurzweilig sozialwissenschaftliche Antworten auf die kleinen und großen Fragen des Alltags. Im Interview spricht er darüber, warum er das macht – und wie die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesellschaft verbessert werden könnte.
Herr Prof. Dr. Friesike, am Weizenbaum-Institut beschäftigen Sie sich mit Transformationsprozessen. Was ist dabei ihr Fokus?
Was mich eigentlich immer umtreibt, ist der digitale Wandel. Und auch, warum dieser vielerorts so schrecklich langsam vonstatten geht. Ich beschäftigte mich außerdem viel mit der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und der übrigen Gesellschaft. Auf der einen Seite wird die Wissenschaft immer komplexer und kleinteiliger in dem, was sie untersucht. Auf der anderen Seite tut sie das aber für die Gesellschaft und nicht zum Selbstzweck. Die damit verbundenen Herausforderungen interessieren mich. Ich habe irgendwie die Tendenz, mich für solche Meta-Fragen zu interessieren.
Mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg produzieren Sie die Videoreihe „Menschen und Muster“. Dort beantworten Sie sozialwissenschaftlich und recht unterhaltsam Alltagsfragen. Was hat das mit Forschung zu tun?
Die Sendereihe mit dem rbb ist im Zuge von Corona entstanden. Die Leute wollten, dass ich Vorträge per Webcam halte, um diese dann ins Internet zu stellen. Ich dachte mir: Das kann irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ich habe im Netz nach Sendungen mit sozialwissenschaftlichen Inhalten gesucht und überraschend wenig gefunden. Also haben wir angefangen zu überlegen, wie man sozialwissenschaftliche Theorie erzählen könnte, mit dem rbb gesprochen, einen Piloten produziert – so nahmen die Dinge ihren Lauf. In letzter Zeit bewegen sich meine Themen ein bisschen weg von dem, was die klassische Wissenschaft macht. Das heißt, die rein innerwissenschaftliche Kommunikation, die ja maßgeblich über Paper passiert, begeistert mich immer weniger. Ich glaube, dass die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft noch besser bespielt werden könnte. Da ist ‘ne Menge Musik drin.
Fällt das nicht eher unter klassischen Wissenschaftsjournalismus?
Wissenschaftsjournalismus erzählt Wissenschaft aus einer journalistischen Perspektive. Unsere Idee – ich arbeite an den Skripten mit zwei Doktorandinnen – ist: Wissenschaft muss selbst erklären können, was sie tut. Die technische Umsetzung, die Illustration, Schnitt etc. machen natürlich Profis im Sender. Wir schreiben die Skripte aus der Sicht der Wissenschaft und versuchen dabei, Theorien durch einen alltagsrelevanten Bezug greifbar zu machen. Unser Ziel ist es, theoretische Konzepte so einprägsam zu erklären, dass Zuschauenden sie in ihrem Alltag wiederentdecken können.
Und das heißt?
Statt Inhalte „runterzudummen“, versuchen wir zu erklären: Es ist kompliziert, aber man kann das alles verstehen, wenn man will, und Spaß machen darf es auch. Hinter den abstrakten und umständlichen Begriffen steckt nämlich auch nichts weiter als Zusammenhänge, die man erklären kann. Man muss das allerdings erstmal alles auspacken. In der Wissenschaft gibt es ein Konzept, das heißt „Physikneid“. Die Physik wird als besonders wissenschaftliche Wissenschaft wahrgenommen. Geben Sie mal „Wissenschaft“ in die Google Bildersuche ein. Sie werden lange durch Laborkittel, Mikroskope und Teleskope scrollen müssen, bis sie etwas aus den Sozialwissenschaften finden. Andere Disziplinen neiden der Physik diesen Status ein wenig. Und deswegen wird oft versucht, eine besondere Wissenschaftlichkeit zu performen – etwa durch eine komplexe Sprache oder komplexe Modelle. Und das sorgt dafür, dass es für Außenstehende immer schwieriger wird zu verstehen. Das schafft natürlich eine Distanz zwischen den vielen relevanten Inhalten und der Gesellschaft.
Wie lässt sich diese Distanz verkleinern?
Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft ein total unterschätztes Vehikel ist. An der VU Universität in Amsterdam gebe ich jedes Jahr ein Doktorandenseminar „Generating Impact with Academic Work“. Da stellen mein Kollege und ich den Promovierenden die einfache Frage: „Warum machst du diese Forschung?“ Eigentlich wollen alle Teilnehmenden damit etwas erreichen, das außerhalb der Wissenschaft liegt; die Welt ein wenig besser machen. Es schockiert sie dann jedes Mal, wenn sie im Laufe des Kurses merken, dass sie keinen Plan haben, wie das passieren könnte. Und dass sie gar nicht dafür ausgebildet wurden, Inhalte der Gesellschaft zu vermitteln. Wir sprechen dann zum Beispiel viel über Kooperationsmöglichkeiten. Man muss nicht alles selber machen können. 2022 habe ich zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Thomas Ramge einen Essay geschrieben, für den wir sogar einen Preis der Hertie-Stiftung bekommen haben. Zu lernen, wie er als Journalist eine Geschichte aufbaut, war für mich total hilfreich. Auch von der Zusammenarbeit mit den Redakteurinnen im rbb habe ich profitiert. Die kommentieren jedes Skript und sagen dann, was ihnen zu abstrakt ist oder welche Vergleiche für sie hinken. Dieses Zusammenspiel finde ich super wichtig. Aber es wird zu wenig unterrichtet, wie man das macht.
Warum ist das so?
Erstmal fehlt die Zeit. Der Druck innerwissenschaftlich zu kommunizieren, also Paper zu publizieren, ist in vielen Fächern extrem hoch. Das saugt anderen Aktivitäten sozusagen die Zeit weg. Aber man muss auch zugeben, dass sich in der Wissenschaft eine gewisse Arroganz bemerkbar macht. Das beobachte ich auch bei den Promovierenden in meinem Kurs. Die sind gern davon überzeugt, dass sie problemlos ein erfolgreiches Sachbuch schreiben könnten, ohne das jemals gemacht zu haben bzw. mit jemandem gesprochen zu haben, der das schonmal getan hat. Diese Fähigkeiten muss man aber im Kleinen erstmal aufbauen. Leute, die das wirklich gut machen, mussten eine lange autodidaktische Strecke hinter sich bringen. Wie man Forschungsergebnisse so kommuniziert, dass sie auch außerhalb des Elfenbeinturms verstanden werden, das wird kaum irgendwo vermittelt. Im Institut bieten wir öfter mal Workshops zu dem Thema an.
Wie reagieren denn Kolleginnen und Kollegen auf ihre Arbeit?
Überraschend positiv. Es gibt in der Wissenschaft immer die Sorge, in die Kritik zu geraten, oder sich sogar zu blamieren. Bisher passiert aber eher das Gegenteil: Kolleginnen und Kollegen melden sich bei mir, schlagen Themen vor und bieten sogar direkt an, mitzuhelfen.
Wie kommuniziert Wissenschaft denn Ihrer Meinung nach am besten?
Die Wissenschaftskommunikation wurde lange geprägt vom sogenannten Defizit-Modell. Danach war es ihre Aufgabe, fehlendes Wissen in der Gesellschaft auszugleichen, damit Wissenschaft akzeptiert und unterstützt wird. Dieses Modell wird inzwischen als paternalistisch erachtet und deswegen weitgehend abgelehnt. Heute setzt man eher auf einen gleichberechtigten Austausch auf Augenhöhe. Wir haben mal eine Studie gemacht zu Science Slams, anhand derer man das gut erläutern kann. Auf der einen Seite müssen die Vortragenden ihre fachliche Expertise glaubhaft herüberbringen. Auf der anderen Seite müssen sie für das Publikum nahbar sein. Und das ist gar nicht so einfach. Wortwahl, Kleidung – früher ist die Wissenschaft deutlich distanzierter aufgetreten. Am Weizenbaum Institut könnten wir viele Projekte überhaupt nicht machen, ohne gemeinsam mit gesellschaftlichen Stakeholdern daran zu arbeiten. Ganz einfach, weil uns deren Perspektive fehlt. Gemeinsam kommt man auf Ergebnisse, die man allein nicht gefunden hätte. Wir nutzen deswegen auch gerne den Begriff eines „Dialogs“. Was etwas irreführend sein kann, denn unsere YouTube-Videos zum Beispiel sind ja eher Monologe. Aber der Entstehungsprozess, der ist eben dialogisch.
Die Themen, die Sie am Institut bearbeiten, kommen also meist von außen?
Meistens haben wir am Institut eine Idee. Häufig existieren bereits externe Partnerschaften, mit denen dann unterschiedlich intensiv gearbeitet wird. Aktuell schreibt eine unserer Doktorandinnen ihre Dissertation über das rbb-Projekt. Sie dokumentiert die Abläufe ethnographisch und analysiert sie im Rahmen ihrer Arbeit. Wir haben eine Reihe weiterer Projekte, wo man teilweise auf uns zugekommen ist und wir einen Zugang bekommen haben, der spannende Forschungsfragen erlaubt. Was wir nicht machen, ist reine Auftragsforschung. Ich glaube, dass wir an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft noch viel mehr machen können. Und dass viele der aktuell drängenden Fragen sich nur bearbeiten lassen, wenn wir gemeinsame Sache machen.
Interview: Ernestine von der Osten-Sacken